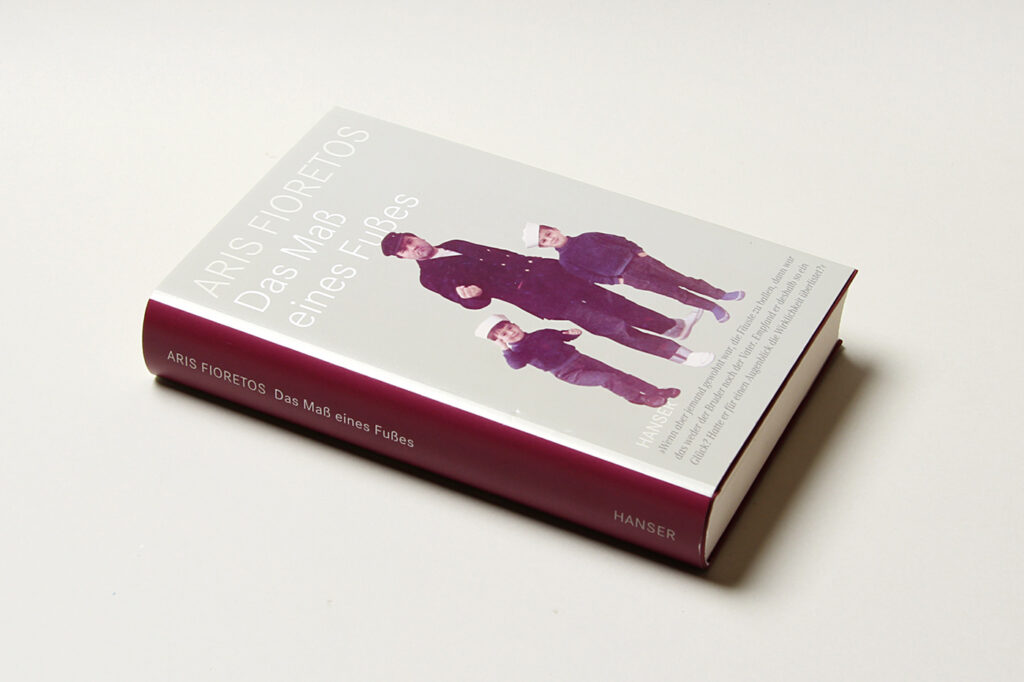
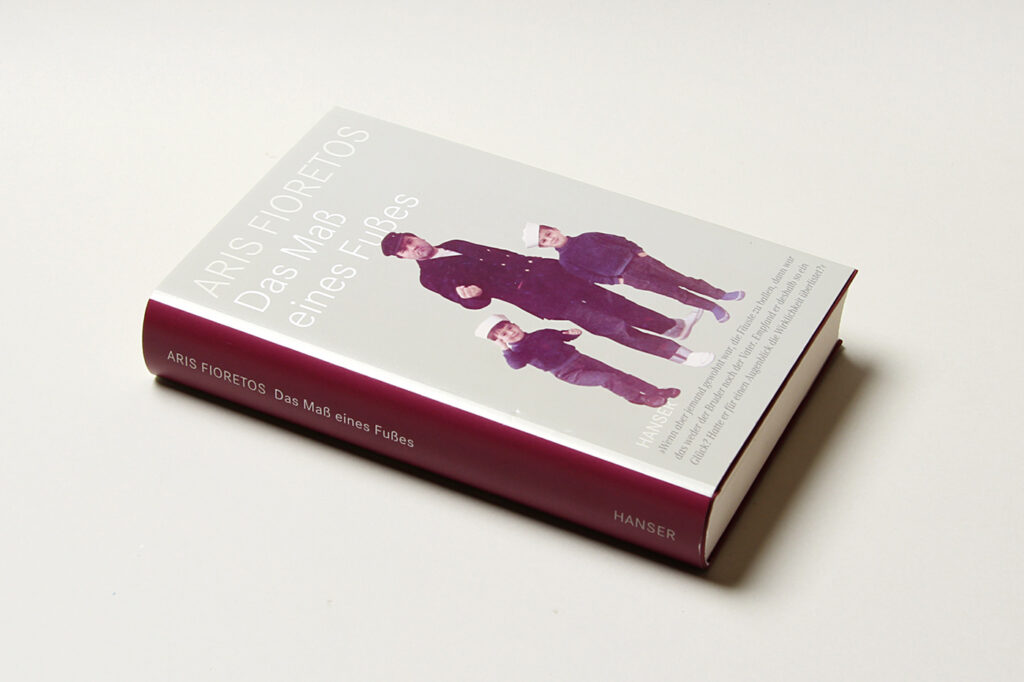

Das Maß eines Fußes
Information · Klappentext · Auszug
Information
Essays · Originaltitel: Vidden av en fot · Übersetzung: Paul Berf · München: Hanser, 2008, 368 Seiten, Abbildungen · Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen · Bild aus dem Privatbesitz des Autors · ISBN: 978-3-446-23056-9
Klappentext
Aris Fioretos öffnet in seinem neuen Buch eine wahre Wunderkammer voller kluger Geschichten und Essays, die den Geist auf lustvolle Weise beweglich halten: Neben anatomischen Feldstudien und einer Exkursion ins Innere des menschlichen Schädels stehen Kindheitserinnerungen, „Bulletins aus der Geschichte des Herzens“ und eine „Liebeserklärung an Fräulein Uhr“. So entsteht Literatur, die das scheinbar Disparate und Gegensätzliche zusammenbringt. Auf der Grenze zwischen Fiktion und Essay balancierend, sind Fioretos Texte ein Lesevergnügen auf hohem Niveau.
*
Aris Fioretos, geboren 1960 als Sohn griechisch-österreichischer Eltern im schwedischen Göteborg. Nach Studien- und Forschungsjahren im Ausland Arbeit nun als Schriftsteller in Stockholm und Berlin. Veröffentlichung mehrerer Prosa- und Essaybände sowie Romanen; Übersetzungen von u. a. Paul Auster, Friedrich Hölderlin und Vladimir Nabokov ins Schwedische
Paul Berf, geb. 1963 in Frechen bei Köln, lebt nach seinem Skandinavistikstudium als freier Übersetzer in Köln. Er übertrug u. a. Henning Mankell, Kjell Westö, Aris Fioretos und Selma Lagerlöf ins Deutsche. 2005 wurde er mit dem Übersetzerpreis der Schwedischen Akademie ausgezeichnet.
Auszug
Noten zu einem Fuß
Gemacht zur Flucht von Anfang an,
Zum Auszug aus dem Paradies.
– Durs Grünbein
1
Eine Urszene benötigt nur wenige Requisiten. In diesem Fall reichten etwas Sonne, ein Paar Hände und ein Blick, täppisch wie ein Welpe. Der Ort: das Ufer eines Sees in Südschweden. Die Zeit: das Jahr, in dem the big bang bestätigt wurde. Genauer gesagt: der heiße Sommer 1965. Eines Tages schlug er die Hände vors Gesicht, worauf das Sonnenlicht zwischen seinen Fingern hindurch sickerte wie rieselnder Sand. Mit jedem Finger, den er krümmte, wurde es heller, bis sein privater Countdown zur Blindheit das Licht so schmerzhaft stark machte, dass Blinzeln nicht mehr genügte und er stattdessen die Augen schließen musste. Auf der rosafarbenen Innenseite der Lider tanzten nun weiße Flecken, stecknadelkopfgroß, im Takt seines Pulses. Langsam schwächten sich die Flecken ab und verwandelten sich in schwarze Punkte – Mininovä, die an seinem inneren Himmel verglühten. Als die Sterne schließlich erloschen waren, hielt er sich die Hände von Neuem wie ein verdrehtes Feigenblatt vors Gesicht. Anschließend öffnete er sachte die Augen und wollte das fatale Herunterzählen der Finger soeben wiederaufnehmen – als plötzlich eine Stimme auf Deutsch ertönte: „Achtung!“ Es war seine Mutter. Grimmig sprach sie nun die Worte, die, wie er erst Jahre später erkennen sollte, bedeuteten, dass er spätestens an jenem Tag den Weg aus dem Paradies antrat: „Einmal und nie wieder.“
2
Schwer zu sagen, wodurch unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand gelenkt wird. Sorglose Neugier? Die zwingende Macht des Schicksals? Oder der Versuch des Verschlagenen, seine unnatürliche Sehnsucht zu stillen? Für den Notar des Seelenlebens in der Wiener Berggasse war die Fixierung auf ein Detail, aufgeladen mit den komplizierten Energien der Begierde, sofort verdächtig. Eine Haarlocke, ein wenig Glanz auf der Nase oder der schuhgeschmückte Fuß des Hausmädchens ließen ihn annehmen, dass der verlockende Gegenstand in Wahrheit eine derart schmerzhafte Erkenntnis andeutete, dass sie verdrängt werden musste. Das Objekt der Begierde war nichts Geringeres als der Platzhalter eines Traumas.
„Wir wissen warum dieses Substitut zum Tragen kommt“, erläuterte er mit einer Gelassenheit, die durchblicken ließ, er hatte die Wahrheit durchschaut. Im Alter von fünf oder sechs Jahren entdeckt das Kind bestürzt, dass der Mutter sein wichtigstes Körperteil fehlt. Nun fühlt es sich bedroht. Wenn die Frau, die ihm am nächsten steht, kastriert wurde, kann auch das Kind nicht damit rechnen, sein liebstes Hab und Gut zu behalten. Instinktiv schließt es nun den Kompromiss, der in seinem Erwachsenendasein solch beschwerliche Freude verbreiten wird. Freud zufolge gibt es jetzt den Glauben auf, dass die Mutter einen Phallus haben sollte – aber nicht völlig: das Glied wird in verschobener Gestalt bewahrt, als Camouflage für eine erschreckende Abwesenheit. Von nun an wird der Junge diese Attrappe mit aller lustvollen List, derer er fähig ist, hegen und pflegen. Gemäß einer später hinzugefügten Fußnote zu den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie bleibt allerdings die Tatsache bestehen: „Der wirkliche Sachverhalt ist der, dass hinter der ersten Erinnerung an das Auftreten des Fetisch eine untergegangene und vergessene Phase der Sexualentwicklung liegt, die durch den Fetisch wie durch eine ‚Deckerinnerung‘ vertreten wird, deren Rest und Niederschlag der Fetisch also darstellt.“
Mit anderen Worten: Der Fetisch birgt eine Geschichte in sich. Er enthält ein zum Rebus erstarrtes Erlebnis, eine als Symbol verkleidete Erzählung. Und funktioniert folglich – wen wundert es – wie eine Fußnote. Man braucht kein Freudianer, oder Fetischist, zu sein, um eine solche Komplikation verlockend zu finden. Wer würde nicht diesen verdichteten Fixpunkt auseinanderfalten und feststellen wollen, dass er genug Platz bietet, um eine verzaubernde Welt zu beherbergen. Wie die Narbe des Odysseus „über dem Knie“, die Eurykleia schließlich erkennen ließ, wessen Füße sie wusch, verweist der Fetisch zurück, auf eine Vergangenheit, die sich plötzlich, überraschend, und wider Erwarten, als gerettet erweist:
Die Narbe betastete jetzt mit flachen Händen die Alte
Und sie erkannte sie gleich, und ließ den Fuß aus den Händen
Sinken, er fiel in die Wanne, da erdröhnte die eherne Wanne
Stürzte auf die Seite herum, und das Wasser floss auf den Boden.
Das Erdröhnen, das der Fuß des Odysseus verursacht, ist das Echo jenes Urknalls, von dem der Fetisch der Überrest ist. Wie eine Fußnote verweist er auf eine Urszene, die so aufgeladen ist, dass sie einzig in verschobener Gestalt bewahrt werden kann, außerhalb des eigentlichen Textes oder hinter der schützenden Kulisse, vor der ein Mensch sein geordnetes – will sagen: erinnertes – Leben spielen lässt.
3
Er war noch nicht geboren, als der Astronom Fred Hoyle 1953 im britischen Rundfunk seine Theorie von einem Urknall vorstellte. Doch zwölf Jahre später, als ein neuer und empfindlicher Mikrowellendetektor die These bestätigte, indem er die Wellen des Knalls im Äther auffing, wusste er bereits, wo das Dasein seinen Ursprung hatte: auf dem Fußboden vor seinem Bett. Damals lag dort ein Teppich. Er bestand aus drei länglich schmalen Teilen, die in den dreißiger Jahren miteinander vernäht worden waren. Das Streifenmuster war rot und weiß und erinnerte an einen Strichcode. Einst waren Muster wie Format des Teppichs eben und regelmäßig gewesen, doch nach zahlreichen Umzügen und einigen Jahren schweren Spielzeugautoverkehrs war er inzwischen arg ramponiert. Er hatte gehört, dass seine Großmutter den Teppich gefilzt hatte, indem sie die Wolle in einem Bach ziehen ließ, der am Haus der Familie an der Westküste des Peloponnes vorbeifloss. Als sein Vater so alt war wie er selbst in diesem Sommer, kehrte er eines Abends heim, nachdem er die Ziegen der Familie gehütet hatte. Etwas oberhalb am Bachlauf pinkelte er in dem Bewusstsein, dass die Strömung den Urin zur und durch die Wolle führen würde. Seither waren Spuren davon in den Fasern bewahrt wie ein verstohlener Gruß von der anderen Seite der Erinnerung. In einer Ecke war der Teppich später verfärbt worden; dort war die weiße Wolle rosa wie eine frische Wunde. Die Erklärung war einfach. Bevor der Teppich vor seinem Bett landete, lag er vor dem der Eltern. Der Fleck entstand in einer Winternacht ein paar Jahre zuvor, als das Fruchtwasser abging und auf den Boden lief.
Wenn er in diesem monumentalen Sommer morgens aufwachte, setzte er folglich die Füße auf den Überrest einer Geschichte, die er selber nicht erlebt, die jedoch seine eigene geprägt hatte – ein „stigma indelebile“, um mit dem Autor des Aufsatzes über den Fetischismus zu sprechen, das seinen persönlichen Urknall ankündigte. Es verblüffte ihn jedesmal, dass der Fleck die gleiche Breite hatte wie seine fünfjährigen Füße.
4
Was es heißt, die eigenen Extremitäten an die Stelle des Ursprungs zu setzen, zeigt jener Philosoph, der traditionsgemäß „der Dunkle“ genannt wird. Im Grunde sollte einen der Beiname wundern. Der Umstand, dass uns Heraklits Denken nur in Form von Fragmenten bekannt ist, führt zwar dazu, die Richtung in vielen seiner Aussagen vage bleiben zu lassen. Doch die Sprache, die er benutzt, ist gleichzeitig klar wie Wasser. Hier findet man nur wenige Reste des sakral gefärbten Vokabulars einer früheren Philosophie. Fast sämtliche Worte entstammen dem Alltag: „Nacht“, „Schlaf“, „Kind“, Krieg“, „Feuer“ … Möglicherweise entsteht die berüchtigte Dunkelheit seiner Texte, wenn diese Elemente des Daseins benutzt werden, um nicht nur die Wirklichkeit zu beschreiben, in welcher der Mensch lebt und wirkt, von den Griechen physis genannt, sondern auch dazu dient, auf jene größere Sphäre zu verweisen, die diese umgibt – die metaphysische. Wie hier, in Fragment Nummer drei:
[Die Sonne hat] das Maß eines menschlichen Fußes.
Als Philologe ist es leicht, einer solchen ebenso sachlichen wie rätselhaften Behauptung verwirrt gegenüberzustehen. Handelt es sich um eine Aussage über den Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was nur zu sein scheint? Macht sich Heraklit zum Fürsprecher jener Sorte von Idealismus, die meint, dass alles ist, wie es wirkt? Oder gestattet er sich im Gegenteil eine Prise Ironie, eventuell gegen die Naturphilosophen seiner Zeit gerichtet, die behaupteten, dass Gegenstände die Größe besaßen, die das menschliche Auge ihnen gab? Am einfachsten wäre es sicher, den Text beim Wort zu nehmen. Denn genügt es nicht, selber einmal am Ufer gelegen, die allerorten gegenwärtige Sonne genossen zu haben und von ihr gleichzeitig gestört worden zu sein? Wenn man mit Hand oder Fuß den Platz des Himmelskörpers einnimmt, entsteht der Lichtkranz, welcher der physischen Welt ihren Nimbus verleiht. Zumindest im buchstäblichen Sinne ist dieser Strahlglanz meta-physisch: Er beginnt, wo Finger oder Zehen enden.
Bei Heraklit tritt der Fuß hervor, indem er die Quelle verbirgt, der er seine Existenz verdankt. Wie die Extremität Teil eines größeren Ganzen ist, bildet die Handvoll Worte, die der Nachwelt erhalten geblieben sind, den Teil eines Zusammenhangs, zu dem uns der Zugang fehlt. Damit wird die Aussage auch zu einem Fragment über das Wesen des Fragments. Der Fuß verhält sich zur verdrängten Sonne, aller Dinge Vater, wie das Bruchstück zu seinem verlorenen Kontext. In gewisser Weise demonstriert Heraklit die Dunkelheit am helllichten Tag: Sein Text erhält sein finsteres Strahlen durch die Quelle, die gleichzeitig ausgeblendet wird.
Im Gegensatz zu seinem rhetorischen Zwilling Aphorismus – der nichts außerhalb seiner selbst benötigt, am wenigsten von allem einen Kontext – wird das Fragment von Unzulänglichkeit gekennzeichnet. Wenn der emsige Philologe sein Bruchstück, entstaubt und analysiert, in einen Kontext einbettet, rettet er es zwar vor dem Vergessen der Geschichte. Aber gleichzeitig behandelt er die Scherbe, als weise sie die fertige Kontur eines Gedankens auf. Die Aussage wird fixiert, ihre Unzulänglichkeit als absichtlich gesichert. Ein solches Bruchstück bildet nicht länger ein Fragment, sondern ein „Fragment“. Es hat seine Strahlkraft verloren und ist in eine Sentenz verwandelt worden. Mit wenigen Ausnahmen ist es diese Verwandlung zum bon mot, die Heraklits Texten widerfahren ist. Das Relevante in ihnen wird nicht länger damit verbunden, was unlesbar bleibt und für ihre geheimnisvolle Aufladung bürgt, sondern mit ihrem kanonischen Status als Klassiker. Doch wenn ein Klassiker in Übereinstimmung mit seiner Lesbarkeit definiert wird, kann ein Fragment niemals kanonisch sein. Im Gegenteil, es verlangt, dass wir stets auch über seinen abwesenden Sinn wachen.
Ist es womöglich das, was Heraklits Aussage über das „Maß eines menschlichen Fußes“ fordert? Dass der Philologe, diese Person, deren Begierde den Worten selbst gilt, während er dem Gegenstand seiner Faszination einen Sinn zu geben sucht, auch dessen aufgeladene, jedoch unzugängliche Quelle bewahrt? Wenn es so ist, wird das Objekt der Begierde nur lesbar als die Spur einer Verdrängung – will sagen: dank ihrer Unlesbarkeit. Die Breite dieser Spur gleicht der abgedeckten Erinnerung, von der Freud in einer Fußnote sprach, und deren umhüllendes Dunkel zugleich elementar und unausweichlich, schützend und strahlend ist. Dies wäre das Drama, zu dessen Wiederholung uns Heraklit einlädt: Jede Note zu seinem Fragment führt die Handlung aus, die sich der Fuß eines Menschen an einem scheinbar unschuldigen Tag am Ufer erlauben kann.
5
Eine Urszene benötigt nur wenige Requisiten. Wenn er heute, Jahre nachdem seine Besessenheit sich von Dingen zu Worten verschob, den Fleck auf dem Teppich betrachtet, der vor seinem Bett zu liegen pflegte, begreift er nicht, warum er es nie sah: Er gleicht einer lodernden Sonne in Miniatur. Hand, Fuß oder Asterisk – mehr benötigt niemand, um ein wenig Dunkelheit zu erschaffen, die einen deutlicher sehen lässt. Oder um jenes Paradies zu verdrängen, das doch nichts von einem wissen will.
Seiten 153–160.