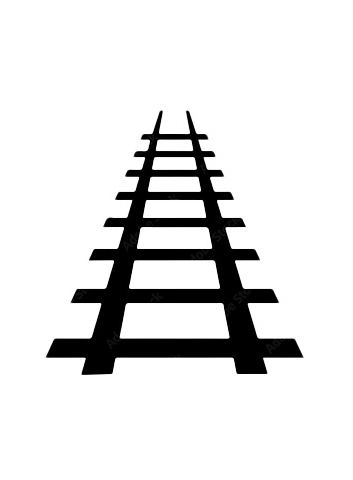
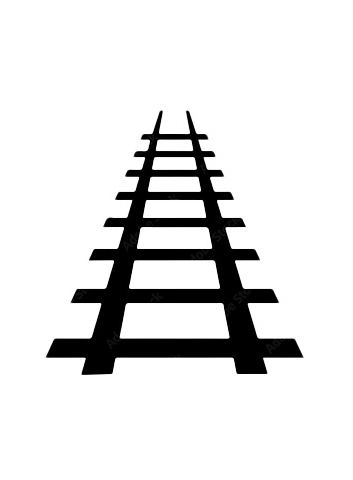
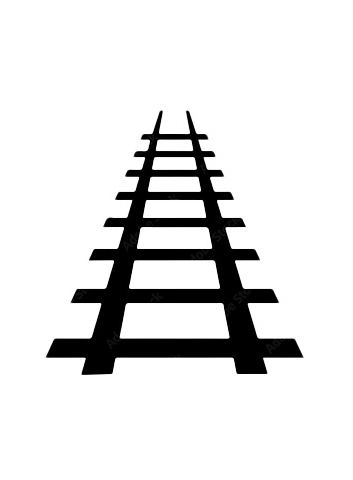
Intensive Wahrnehmung von Gegenwart
Interview von Dirk Frank · UniReport · Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2024, Ausgabe 3, S. 15 · UniReport
Sie haben griechische Wurzeln, sind in Schweden aufgewachsen und Ihre erste Sprache war Deutsch. Gibt es gewissermaßen eine sprachliche Heimat Ihrer literarischen Produktion, läge diese eher in der Mehr- oder Vielsprachigkeit?
Auch wenn ich mich geographisch nirgendwo wirklich beheimatet fühle, bin ich an vielen Orten zu Hause. So ist es wohl auch mit den drei, vier Sprachen, in denen ich halbwegs aufrecht und bodenständig wandele. Zweimal im Leben habe ich überlegt, als Schreibender in eine andere Sprache zu wechseln – ungefähr so, wie Züge Gleise wechseln. Das erste Mal war Mitte der neunziger Jahre in den USA, das zweite im folgenden Jahrzehnt als sesshafter Berliner. Beide Male bin ich jedoch beim Schwedischen geblieben – diese Nebengleissprache, die ich nie als „meine“ habe betrachten können. Gott, nein, die Musen wissen, warum. Das Leben wäre wesentlich einfacher geworden, wäre ich auf dem high speed rail des Amerikanischen geblieben, oder im ICE des Deutschen. Ich bin bedenklich loyal… Glauben Sie mir, als Schriftsteller wäre ich gern opportunistischer, oder zumindest weniger bockig.
Sie haben zahlreiche Autoren ins Schwedische übersetzt, u.a. den gerade verstorbenen Paul Auster. Was fasziniert Sie an ihm, was macht seine Romane für Sie so wertvoll?
Wir haben uns Ende der achtziger Jahre kennengelernt, ich wohnte noch an der Upper West von Manhattan. Mit meiner damaligen Freundin ging ich oft ins Moon Palace am Broadway, ein Restaurant, das es längst nicht mehr gibt, das den Titel für einen von Pauls Romanen liefern sollte. Als wir uns zum ersten Mal trafen, sprachen wir über die beiden O’s im Namen. Waren sie Vollmonde, waren sie ein Paar Augen? Oder gar zwei Heiligenscheine? Offensichtlich teilten wir eine gewisse Sensibilität dafür, wie Worte jenseits der Semantik bedeuten können – durch ihre graphische Gestalt, durch die Art, wie die Buchstaben arrangiert sind, durch sonore Zufälle.
Nicht lang zuvor war Paul nach Brooklyn gezogen. Ich erinnere mich, wie ich ihn an seiner damaligen Arbeitsstätte besuchte. Es war ein dunkles Studio von fünfzehn, vielleicht zwanzig Quadratmetern; ich glaube nicht, dass er oft die Rollos hochzog. Wie üblich in den USA trug die Flurtür eine Ziffer sowie einen Buchstaben. Da das Studio im Erdgeschoss lag, war die Ziffer naturgemäß 1. Und der Buchstabe? Der Zufall wollte, dass Paul im „I“ hauste. Also 1I – zu deutsch: „ein Ich“… Für jemanden, der damals schon viel über Einsamkeit geschrieben hatte, schien die Bezeichnung nicht unpassend.
Anfang der neunziger übersetzte ich einige Texte von Paul – erst Gedichte und Kurzprosa, dann Die Erfindung der Einsamkeit und zuletzt Das rote Notizbuch (kurze Fassung). Besonders seine lyrische Kurzprosa – allen voran das Titelstück von White Spaces – sowie die Erinnerungen an seinem Vater zogen mich an. Später, als ich eine Zeit lang in Baltimore wohnte, half ich sogar bei einer Szene im Roman Timbuktu. Die Hauptfigur ist ja ein Hund; in einem Kapitel streunt er die Straße entlang, in der Edgar Allan Poe einst gelebt hat. Paul wollte wissen, wie das Haus aussah, wo der Meister der amerikanischen Angst gewohnt hat, war aber zu beschäftigt, um die Reise nach Baltimore anzutreten. Also trottete ich mit einer dieser Wegwerfkameras los, die es damals noch gab, um die Fassade zu dokumentieren. Als er mir den Roman später schickte, ich wohnte schon in Berlin, trug das Buch eine Widmung, in der es unter anderem heißt: „For Aris – who, in effect, wrote the second paragraph on p. 44 – – !“ So bin ich während neunzig oder so Worten zu seinem Co-Autor geworden.
Nach dem Umzug nach Berlin, verlor ich Pauls Werk allmählich aus den Augen. Wir trafen uns jedoch so oft es uns die Geographie erlaubte – erst im Exil, dem berühmten Restaurant in Kreuzberg, das es auch nicht mehr gibt, später bei gemeinsamen Bekannten und gelegentlich auf Lesungen oder Festivals. Ich mochte den Menschen sehr – seine Aufmerksamkeit, seine zärtliche Sachlichkeit. Paul blieb den Buchstaben treu, für ihren unerwarteten Abenteuer stets offen.
In Ihrem Roman Der letzte Grieche, Teil einer Trilogie, geht es um das Schicksal eines griechischen Migranten in Schweden. Der Roman ist 2011 erschienen – seitdem hat das Thema Flucht und Migration in Europa an Fahrt aufgenommen, die Migration hat sich in Europa sozusagen vom Innereuropäischen ins Globale verlagert. Wie schauen Sie auf die momentane Situation, auch in einem Einwandererland wie Schweden?
Sicher nicht mit Freude. In der Vergangenheit schien Schweden – jahrein, jahraus – seine Identität als Konsenskultur erfolgreich zu pflegen. Nun häufen sich die Anzeichen dafür, dass auch wir uns, wie viele andere Nationen vor uns, in eine Konfliktgesellschaft wandeln. Für jede politische Bestrebung in die eine Richtung gibt es eine in die Gegenrichtung. Erstere scheint aber deutlich schwächer zu sein, so dass auch Schweden, die einstige fleischgewordene Sozialutopie im Norden, sachte aber stur nach rechts driftet.
In demokratische Gesellschaften sind Meinungsverschiedenheiten nicht nur möglich, sondern meistens auch förderlich. Es gibt jedoch eine neue Unerbittlichkeit im Dissens, die ich von früher so nicht kenne. Einiges, glaube ich, hat mit Ressentiments zu tun – und mit Parteien wie die Schwedendemokraten mit ihrer regressiven Nostalgie, die diese behutsam zu pflegen wissen. Wenn soziale Ressourcen knapper werden, wenn das Leben nicht länger so zu sein scheint, wie es „einst“ angeblich war, wird nach Gründen gesucht – und diese werden, wie die Faust aufs Auge, schnell unter den Zugewanderten verortet. Inzwischen soll jeder fünfte Einwohner bei uns ausländischer Herkunft sein; wen wundert es, wenn dies bei endlichen Ressourcen, und also auch bei Verteilungsfragen, zu Spannungen führt?
Bis vor zehn Jahren galt die Immigration als die Universallösung für die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt und in der Altersvorsorge, die unsere damalige konservative Regierung für die Zukunft ziemlich präzise prognostizieren wollte. Das war damals ebenso überzogen wie heute die Verdammung. Nicht alle Parteien delirieren gleich, wie die Rechte, von der Islamisierung des Abendlandes, aber auch wenn in manchen noch zaghaft – durch die böse Blume – gesprochen wird, versteht jeder Bürger, jeder Bürgerin, die Ohren besitzen, was gemeint ist. Härtere Gesetze bei der Einwanderung, beim Asylverfahren, beim Bleiberecht, ganz zu schweigen vom Klimawandel oder der russischen Invasion in Ukraine, sollen irgendwie die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit sein? Ich sehe nicht ein, wie das die Mängel im Bildungswesen oder in den Krankenhäusern beheben und schon garnicht die staatliche Steuereinnahme erhöhen könnte.
In Ihrem aktuellen Roman Die dünnen Götter hat man es mit einem Sujet zu tun, das für die Boomer-Generation interessant sein dürfte: Ein gealterter New Yorker Rockmusiker, der in Berlin lebt, wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Verbindet Sie viel mit der (selber in die Jahre gekommenen) Rockmusik, was hat Sie daran interessiert, um diese populäre Musikrichtung für einen Roman aufzugreifen?
Neulich musste ich mich von meiner Tochter überreden lassen, dass ihr Vater – doch, doch – sehr wohl zu den Boomer gehört. Bis dahin dachte ich: „Boomer“? Was für eine bescheuerte Bezeichnung. Das sind doch Urgesteine wie Bill Clinton oder Maria Furtwängler oder Rudi Völler. Aber ich doch nicht? Dann habe ich erfahren, dass es sich laut den Soziologen um Menschen handelt, die zwischen 1945/46 und 1964 geboren wurden. Notgedrungen zähle ich also dazu. Außer mit Paul Auster und ein paar weiteren Freunde, teile ich mit Menschen, die bis 1956, 1957 zur Welt gekommen sind, allerdings herzlich wenig. Sie sind die Älteren, die in meiner Erfahrung weltberühmt dafür geblieben sind, sich vor allem um ihre eigene Vortrefflichkeit zu kümmern. Aber gut, ich muss die Weisheit meiner Tochter anerkennen. Ein Nachkömmling der Boomergeneration zu sein, ein Boomerchen, welch Schmach für einen Vierundsechzigjährigen. Reden wir lieber über Musik.
Im Herbst 1976, als ich mich als Sechzehnjähriger gewaltig über meine uralten Generationsgenossen ärgerte, lief am späten Sonntagabend im Schwedischen Radio noch eine Sendung mit dem Titel „Daheim bei“. Eines Abends spielten die beiden Äther-Anarchisten, die die Sendung machten, eine unbekannte Band aus New York. Die Gruppe war Television, die Debüt-Single, die sie gerade veröffentlicht hatte, hieß „Little Johnny Jewel“. Ich war wie elektrisiert. So klang, fand ich, mein inneres Körpergewebe, das zwischen Knochen und Haut für Leben sorgte. Am nächsten Tag tauschte ich schwedische Kronen gegen Dollar und schickte das Geld an das unbekannte Label Ork Records. Ein paar Wochen später war ich glücklicher Besitzer einer Platte mit blutrotem Etikett. Seither habe ich Televisions Alben tausende Male gehört. Ihre Musik war die erste, die mich erkennen ließ, dass in der Kunst Dinge kombiniert werden können, von denen ich geglaubt hatte, sie passten nicht zusammen: Coolness, Nerven, Transzendenz. Der Roman ist mein verspäteter Dank an die Band.
Wenn Sie auf die bisherigen Frankfurter Poetikdozenturen zurückschauen: Gibt es Autor*innen, die Sie (besonders) geprägt haben?
Die meisten Namen sind mir gut bekannt, mit einigen bin ich persönlich befreundet. Für die Art von Literatur, die ich schreibe, hat mich keiner von ihnen besonders geprägt, fürchte ich, aber als kluge Köpfe und listige Seelen stehen viele mir mit ihren Werken nah. Ich mochte Oskar Pastior sehr, mit dem ich ein paar Jahre Nachbar war, dessen Texte allerdings von einem anderen Planeten als meinem zu stammen schienen. Mit Durs Grünbein verbindet mich seit inzwischen dreißig Jahren eine Freundschaft, die sich ab und zu in Publikationen niedergeschlagen hat und die uns unter anderem zur Toteninsel vor Venedig, zum New York des Ground Zero und in die Mojave-Wüste geführt hat. Die Liste ehemaliger Poetikdozenten, die ich schätze, ist allerdings zu lang, um sie alle aufzuzählen. Ich bin geehrt, fortan unter ihnen zu sein – und von Judith Schalansky beerbt zu werden, deren wildem Wissen ich gern zujubele.
Können Sie uns schon einige Themen und Aspekte verraten, die in Ihrer Poetikvorlesung zum Tragen kommen werden?
Der Titel – „Solarplexus“ – umkreist hoffentlich das Wesentliche. Es wird um den Körper eines Schriftstellers gehen. Genauer genommen: in drei Betrachtungen hoffe ich herausfinden zu können, wie die intensive Wahrnehmung von Gegenwart, die ein in Wasser herabgesenkter Körper auslöst, in Literatur umgesetzt wird. (Ich gestehe: Ich bin Badewannefanatiker.) In der ersten Vorlesung möchte ich das Verlangen als Bedingung von Texten besprechen. In der zweiten wird über den Hunger als fordernde Erfahrung nachgedacht. Schließlich geht es in der dritten um Elektrizität – Nerven, Zittern, Vibrieren – als eine Art, sowohl in sich als auch außerhalb seiner selbst zu sein. Anders gesagt: Was macht die Literatur dringlich, empfindlich, konzis? Ja, wie, bitte schön, können Wörter sich wie Fleisch anfühlen?