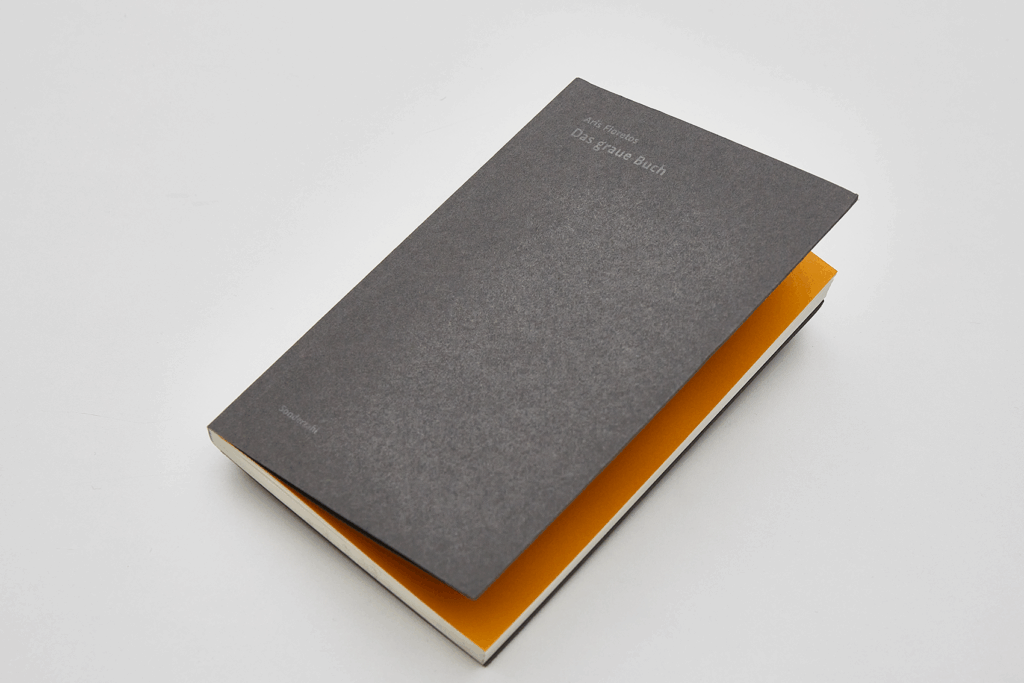
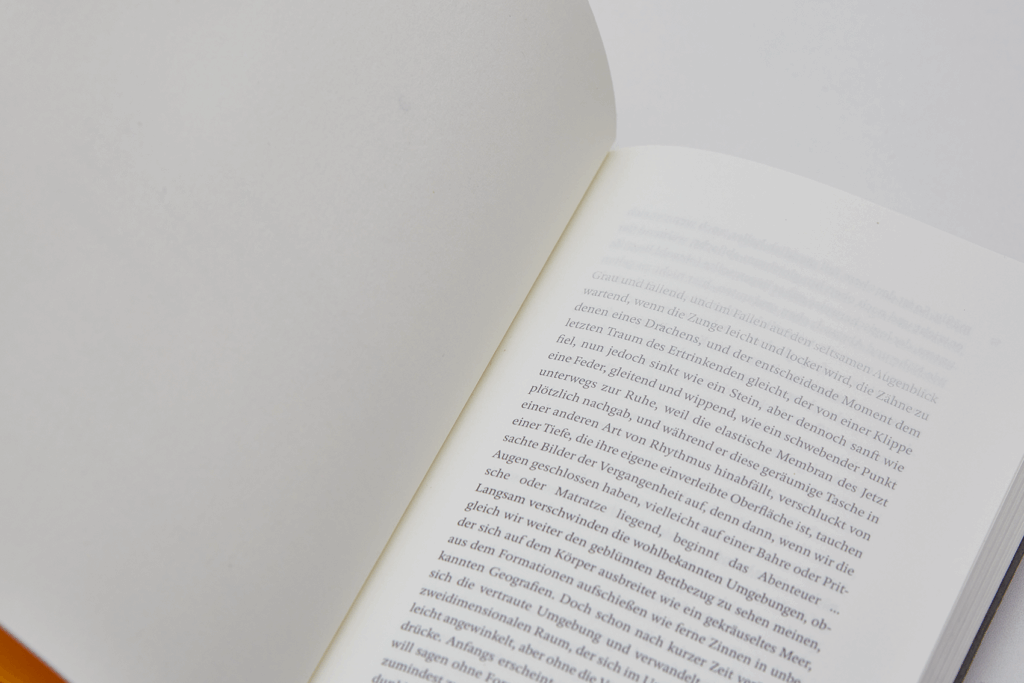
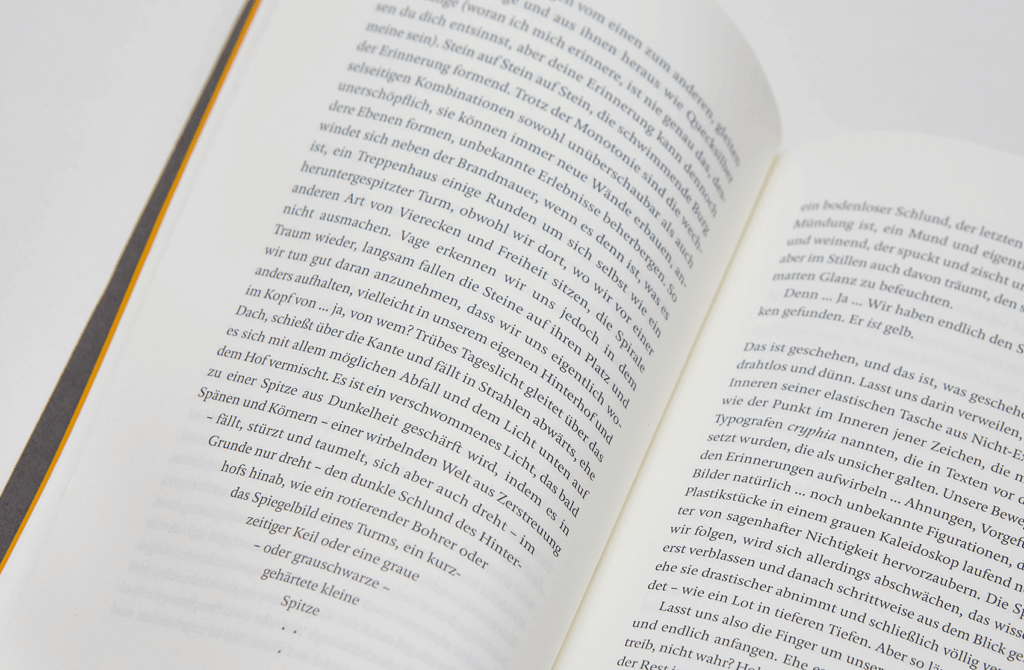
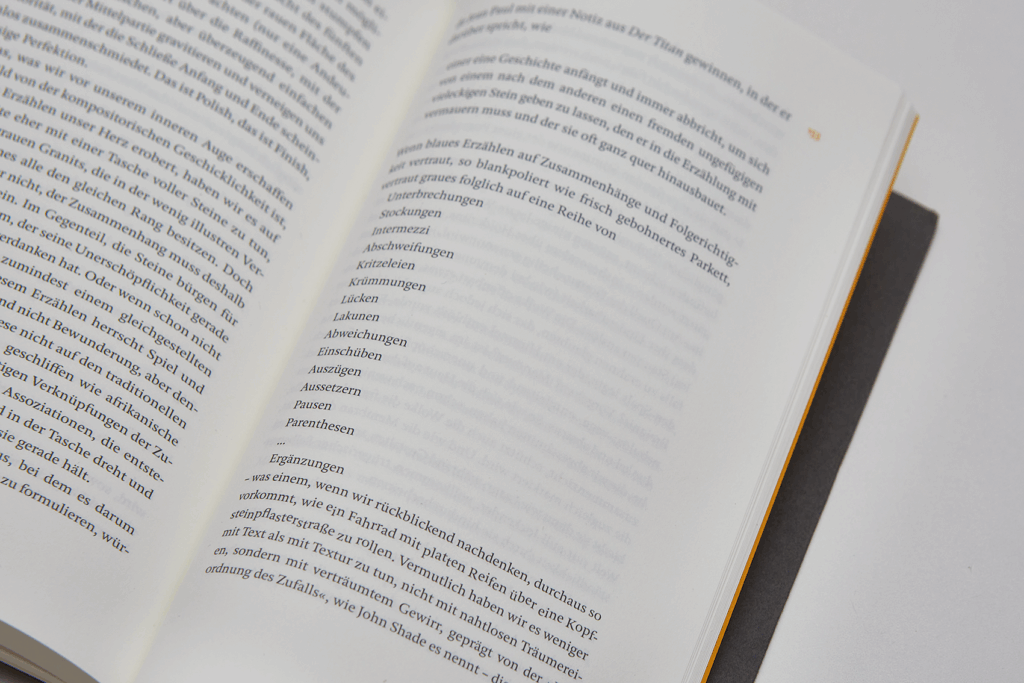
Das graue Buch
Information · Katalogtext · Auszug · Rezensionen · Links
Information
Essay · Originaltitel: Den grå boken (1994; 2019) · Übersetzung: Paul Berf · Wien: Sonderzahl Verlag, 2025, 174 Seiten · Umschlag und Gestaltung: Matthias Schmidt · ISBN: 978-3-85449-675-5
Katalogtext
Die Farbe Grau steht gemeinhin für Unbestimmtheit. Grau, das sind die Übergänge, jene Stellen und Momente, wo das helle Licht des Tages schwindet und die klaren Kontraste undeutlich werden. Aris Fioretos begibt sich mit seinem furiosen Essay, der nun erstmals auf Deutsch vorliegt, mitten hinein in diese Zone der Schattierungen, des Flüchtigen und Vergänglichen. Das graue Buch speist sich aus den Schwellenbereichen, die unserem auf Kontrolle, Sachlichkeit und Wissen ausgerichteten Blick üblicherweise entwischen: Es erkundet die »gräuliche Wärme« jenes Moments, bevor der Schlaf uns ereilt, wie auch den mehrdeutigen Raum des Denkens und des Erinnerns, den wir uns erst anhand von feinen Nuancen selbst anschaulich machen können: »Uns reicht es zu grübeln, und damit in einer Region zu bleiben, die zwar vage ist, in der wir jedoch weder nach der Wahrheit noch uns selbst tasten, sondern nach ›etwas‹ dazwischen. Mit anderen Worten: nach dem Grau.«
Mit spielerischer Leichtigkeit vermisst Fioretos einen Raum, der uns zugleich sehr nahe liegt und sich dennoch wie von selbst seiner Benennbarkeit entzieht. Daher erschafft sich Das graue Buch buchstäblich sein eigenes Genre, indem es den reichen Erfahrungsschatz der Literatur – von Homer bis Beckett – durchmisst, alle verfügbaren sinnlichen Register bemüht und Korrespondenzen auftut, die unvermutete Einsichten in unscharfe Sphären ermöglichen. Die dicht gewobenen Resonanzen, die Phänome der Vagheit in ungeahnt lustvoller Form lesbar machen, entspringen einer Schreibweise, die ganz auf die Erschließung der Grauzonen ausgerichtet ist – als wäre das Buch selbst mit Bleistift geschrieben. Eine Metapher, die veranschaulicht, dass die Funktionen unseres Sprechens und Denkens dort literarisch in den Blick rücken, wo Fioretos versucht, die flüchtigen Momente des Lebens poetisch zu ermessen.
Der Text, der bereits 1994 erstmalig auf Schwedisch erschien, wurde für die vorliegende Ausgabe im Lichte der amerikanischen Übersetzung des Autors (1999) von ihm überarbeitet. Er gliedert sich in fünf Abschnitte: Nach einer Einleitung umkreist er vier Motive, die wie graue Elemente in die Randgebiete des Bewusstseins führen: Tränen, Rauch, Körnung und Wolken. »›Ein Essay über das Nichts‹ hätte Henry Fielding es genannt. Eine Studie in Grau, sagen wir.«
Auszug
Vor dreizehnhundert Jahren wurde die Null, diese so eigene Figur, aus einem der Regale im hinduistischen Zahlensystem heruntergeholt, poliert und um den Hals des Kamels eines arabischen Handelsreisenden gehängt. Er hieß weder Mustafa noch Abdul. Anschließend legte sie eine mühevolle Reise durch Wüsten, so trocken wie die Häute, auf die sie geschrieben wurde, und über Wasser, so bodenlos wie ihr Inneres, zurück. Bis sie die westlichste Grenze des Kontinents erreichte und innerhalb der arabischen Mittelmeerkultur in Umlauf gebracht wurde. Das christliche Europa konnte mit der Ziffer nichts anfangen und verwarf sie. Auch theologische Motive spielten vermutlich eine Rolle, zumindest in dem Maße, in dem sie auf Prinzipien basierten, die der griechischen Philosophie entliehen waren, in der eine Schöpfung ex nihilo unvorstellbar war. Erst im vierzehnten Jahrhundert, als Kapitalisten im Norden Italiens die merkantile Bedeutung der Ziffer erkannten, fand die Null europäisches Gehör. Für die Handelsreisenden, Architekten und Wissenschaftler der Renaissance bildete eine abstrakte Arithmetik die notwendige Voraussetzung für wirtschaftlichen und technischen Fortschritt, was bedeutete, dass die arabische Mathematik nicht mehr mit den gleichen voreingenommenen Zöllen belegt werden konnte wie andere importierte Güter, und nicht mehr daran gehindert wurde, auf einem Markt eingeführt zu werden, den sie neugestalten konnte. Doppelte Buchführung und das aufkommende Bedürfnis, zukünftige Gewinne und Verluste zu kalkulieren, sorgten schnell dafür, dass die hinduistischen Ziffern ihre römischen Verwandten verdrängten. Die Rechentafeln wurden zur Seite geschoben, Papier und Stift kamen zu Ehren, gestische Rechenoperationen wurden von grafischen ersetzt. Eventuelle Einwände mussten mit Hüten so spitz wie gleichgestellte Hypotenusen in der Ecke stehen.
Diese Revolution erforderte jedoch, dass die Null geschrieben wurde. Auf den Rechentafeln der Römer war sie nur durch eine Abwesenheit markiert worden, die zwar angewandt, aber nie erwähnt wurde. Sie bildete nicht so sehr ein Zeichen, sondern die Abwesenheit eines Steins oder Holzstücks in einer oder mehreren Reihen des Kugelrahmens. Mit der Einführung arabischer Mathematik – in der 0 ein fixiertes Zeichen in einer gegebenen numerischen Reihe bildet, das unabhängig von physischer Verkörperung existiert – bekam die Null allerdings sowohl Namen als auch Gesicht … nothing can to nothing fall, / Nor any place be empty quite, wie es bei John Donne heißt … und erhob den Anspruch, buchstäblich für nichts zu stehen: 0 wurde der Platz für alles, was keinen Platz hatte. Eine Ortsangabe so leer wie ihr eigener Anfangsbuchstabe.
Das heißt auch, dass die Null eine doppelte Funktion erfüllt. Sie steht zum einen für das, was die Mathematiker die leere Menge nennen, also die Klasse der Abwesenheit einer gewissen Sorte von Objekten, zum anderen bezeichnet sie den Anfang eines Prozesses. Einerseits ist sie eine Kardinalzahl, andererseits eine Ordnungszahl. Das Ende eines Seils oder der Kreis, den es auf einem Fußboden formt. In beiden Fällen muss sie jedoch als eine Zahl betrachtet werden, die für die Abwesenheit von Zahlen steht: Die Null deutet auf den Ursprung für eine (leere) Quantität oder den Punkt hin, der Vorläufer ausschließt. Sowohl Container oder Urne als auch Markeur oder Füllung. Badewanne und Schwimmer. Erstere Figur kann man sich unmöglich nicht als einen Zirkel, Kringel oder Kreis vorstellen; letztere muss als Punkt oder Markierung gedacht werden. Ring und Fingerspitze, wenn wir so wollen. Ein Katalog über alles, was diese doppelte Figur nicht ist – die endgültige leere Menge –, dürfte deshalb, wie aneinander befestigte Ösen, nicht nur kein Ende haben, sondern auch einbeziehen, was sie nicht ist, ohne sich deshalb davon ausfüllen zu lassen.
Null ist also weder Gliederpuppe noch Mensch (oder auch nur ein Hund) aus Luft. Sie ist weder eine schwache Nummer, der Punkt, an dem Wasser gefriert, noch die Schnittlinie zwischen Horizont und schreibendem Stift. Eine blanke Seite oder ein ungefüllter Füllfederhalter ist nicht nichts, die Person vor dem leeren Blatt ist keine Null, auch wenn das Schild an der Tür den Briefträger auffordert, mit Null markierte Postsendungen dort abzuliefern; die Abwesenheit von Tageslicht in dem Zimmer, in dem er sitzt, ist nicht nichts, auch die Stille, der er lauscht, ist nicht abwesend oder ihre mögliche Durchbrechung nicht ein schöpferisches Körnchen. Weder die Glatze des Rentners noch der Nabel an seinem Bauch ist null. Der Schaltknüppel im Leerlauf bedeutet nicht, dass er auf null steht, oder eine glücklich gelöste Ehe, dass sie ohne Gewinn und Verlust gewesen ist. Null ist nicht der lautlose Ruf des Verblüfften oder das leere Tasten des Liebestollen. 0 bildet auch nicht des Letztgenannten ständig erneuerte Anrufung – ein Apostroph, so hohl wie die Zähne im Mund des Leckermauls – oder den Rettungsring, der Ersterem zugeworfen wird, als er erkennt, dass das Wasser tiefer ist, als er geglaubt hat. Null ist nicht die Insel, auf der sich der Schiffbrüchige dreizehn Jahre von Wurzeln und Beeren ernährt hat, nicht das Floß, auf dem es ihm schließlich gelungen ist, seine Isolierung zu verlassen, oder das Loch als Folge des schlecht montierten Mastes, das den schwimmenden Untersatz sinken ließ – oder auch der Äquator, an dem er von einem Frachter mit einem Schiffer in blauem Fischerhemd, zwei Matrosen in Mänteln, mit Silberknöpfen zugeknöpft (schimmernd wie trockenes Eis und auch sie nicht null) sowie einer Frau mit einem Kind an ihrer Brust, gerettet wurde. Null ist nicht Gott.
Als Poe, in der Novelle »X-ing a Paragrab«, einen gewissen John Smith, der sich in Nopolis niedergelassen hat, herausplatzen lässt: Why, the fellow is all 0!, ist seine Beurteilung von Mr Touch-and-go Bullet-head nicht null und nichtig. Obwohl es heißt, dass ehrgeizige Studenten neue Kameraden während der ersten Wochen des Herbstes »nullen« und der Elektriker das gleiche tut, wenn er die Steckdose erdet, bestehen ihre Aktivitäten weder aus demselben noch im nichts. Null ist nicht, was sich unter dem Bett des Kindes befindet, das sich im Dunkeln fürchtet, der Abdruck, den hochhackige Schuhe auf weichem Untergrund hinterlassen oder der unregelmäßige Rand in dem Käsebrot, das nicht aufgegessen wurde. Sie ist nicht das Rauschen, das auf Krapps letztem Band folgt, die Stille, die eintritt, wenn der Zug den Bahnhof oder Tunnel verlassen hat, in dem er sich befindet, während er unter dem Fluss herfährt, auf dem soeben ein Floß ohne Mast sinkt. Die Heimkehr des Odysseus nach Ithaka beschreibt keine Null, obwohl sein Name mit jenem Buchstaben beginnt, mit dem die Ziffer häufig verwechselt wird, und obgleich er selbst sich Niemand nannte, um dem rohen Hunger des Zyklopen zu entfliehen. Null ist auch nicht das einzige Auge des Riesen, das glitschige Loch, als es ausgestochen wurde (die Wangen hinabrinnend wie eine trägere Sorte Tränen), oder sein unermesslicher Zorn. Null ist nicht die Kerze, als sie zu einem heißen Matsch in der Mitte des Ständers heruntergebrannt ist oder Ophelias Schoß, in den Hamlet seinen Kopf legen wollte. Und mit Sicherheit nicht das dunkle Loch, das entstand, als eine Eiche in einem starken Sturm umgerissen wurde, oder der leere Umschlag, den Herr Null aufschlitzt. Und am wenigsten von allem ist sie der Salto mortale, den der Trapezartist ausführt, ehe er erneut die leeren Hände seines Kollegen ergreift, die nicht nichtexistent sind.
Null mal null ergibt nicht die Kreise in Dantes Inferno, die Stockwerke auf der Anzeige in einem Aufzug, die Ringe von Gläsern auf einem Tisch aus Glas oder Träume von Träumen, platte Fahrradreifen, die Stempel von Glühbirnen auf der Netzhaut, wenn die Augen wieder geschlossen werden, Brüste ohne Kindermünder oder Kindermünder ohne Brüste. Nullen sind weder die Ösen in einem Spiralblock noch aufgeblasene Backen, Eiswürfelbehälter ohne Wasser oder he hoppla ohne Waffen – oder auch das Wort ohne in Wiederholungen ohne Ende. Auch Eier, Münzen und Königskronen sind nicht null und nichtig – oder Backformen, Ohren, Hoden, Sonnenfinsternisse und Sonntage. Nullen sind keine Knopflöcher.
Der Punkt, der nicht gleich null ist, ist offensichtlich. Ein Katalog über alles, was die Ziffer nicht ist, bleibt unerschöpflich, denn selbst wenn es uns gelänge, sämtliche Alternativen aufzuschreiben und jeden einzelnen Aspekt und Gegenstand aufzuzählen, der nicht 0 ist, uns selbst eingeschlossen, würde die Liste übrigbleiben – auch wenn wir sie als letzten Posten einschlössen, bevor sie enden würde. Was bedeutet, dass der Katalog, so ausführlich er auch sein mag, und er muss den Anspruch erheben, erschöpfend zu sein, keine leere Menge bildet, und somit nicht null ist. Sie muss außerhalb ihrer selbst fallen, wie die Ringe nach einem Stein, der vom Wasser abprallt. Null ist nicht null ist … nicht … Dennoch ist die Ziffer listig wie ein Autohändler, wenn es diese Tatsache zu verbergen gilt, denn wenn wir die Einsicht in mathematischer Manier niederschreiben – 0+0+0+ … (oder auch 0-0-0- …) – ist das Ergebnis trotz allem = 0. Wie russische Puppen verbirgt jede Null die Null, die sie nicht ist unter den Säumen ihrer Röcke.
Null ist somit höchstens ihre eigene Division, ohne dass sich die Ziffer deshalb begradigen lässt und zum Schrägstrich zwischen den beiden Leeren 0 und 0 wird. Wie das Zeichen, das für Prozent steht. Oder eine geschlossene Schere. (Aber hier könnten wir uns unanständigere Metaphern vorstellen.) König Lear – an 0 without a figure, a nothing – vermag diese eigentümliche Gleichung nicht zu begreifen, was ihn alles kostet, das er besitzt, inklusive Reich, Augenlicht und Verstand. Kurz vor dem Ende von Shakespeares Stück, wenn fast alles verloren ist, versucht diese 0-Figur an Cordelias Herz zu appellieren, indem sie eine Familienfantasie beschwört, die ebenso suspekt ist wie die Metapher, die wir zu übergehen wählten: ein »Gefängnis« in dem die beiden, allein wie »Gottes Spione«, »singen werden wie Vögel in einem Käfig«.Lear träumt von einem Ort, den es in der Geografie nicht gibt, der Karten fremd ist, in jeder Topografie fehlt. Die Zelle hinter den schweren Gittern der einzelnen Dinge (I I I I I I). Dies ist ein Platz in Ermangelung von Raum, jenseits des Tumults der Wirklichkeit, unerreichbar für die Tentakel der Macht und verschont von der Vergänglichkeit der Zeit. Hier können Vater und Tochter in unwirklicher Unberührtheit leben. Folglich ist es eine Grauzone, wohl am ehesten eine Heimstatt der Gespenster, wo alles »sozusagen« geschieht. An diesem ortlosen Ort (ein weiterer Posten auf unserer Liste) glaubt der König, mit Cordelia als heimliche Agentin und Stellvertreterin leben zu können – will sagen als Zeichen für Zeichen. Am Ende lässt Shapesphere, wie er in Finnegans Wake genannt wird, Lear also den flüchtigen Charakter des »Nichts« erkennen, das er verkörpert. Was natürlich zu spät ist. Lear ist sein eigener Mangel geworden, er ist leer.
Seiten 102–107.
Rezensionen
„In dem schönen und ungewöhnlichen Essay, den Aris Fioretos über das Grau und seine Eigenschaften und Geheimnisse geschrieben hat, wird dieser vornehmsten Farbe des Mangels und der Tristesse reichster Inhalt abgewonnen. . . . Durch das Buch leuchtet das Grau in der Literatur, der Sprache, dem Alltag und der Seele immer stärker und klarer, im prosaischen Schöpfergrau des Bleistifts ebenso wie in der subtilen Konturlosigkeit der Wolken, in der Rätselhaftigkeit der Tränen und im Grau des Gräuselns. – Allt om Böcker
„Er schreibt elegant. Sein Stil ist gleichzeitig verschlungen, suchend und sehr selbstbewusst. Walter Benjamin, über den er geschrieben hat, ist sicher eines seiner Vorbilder. Es gibt zudem rein lyrische Partien im Text: zahlreiche schöne Einzelheiten und sichere Übergänge. Manchmal wird der lyrisch assoziative Textfluss unterbrochen, um anschließend eine neue Richtung einzuschlagen und eine andere Stringenz zu bekommen. Aris Fioretos ist furchtlos und wagt sich mit einem Buch wie diesem weit vor, verführerisch und geschickt geschrieben, auf Gegenkurs zu eng gesetzten Genregrenzen und mit einem offenkundigen Theoriebewusstsein als Grundlage. Die Lektüre wird kaleidoskopisch, stimulierend in ihrer Vielfalt . . . “ – Pär Yngve Andersson, Motala Tidning
„Fioretos schreibt einen Essay, der so schön ist wie Poesie.“ – Nina Björk, Helsingborgs Dagblad
„Hat man sich lange mit Büchern beschäftigt, lässt man sich fast unausweichlich von Fioretos’ Rhapsodie in Grau mitreißen. . . . Trotz seines scharfen Gehörs für Dissonanzen scheint er mir ein besonders begabter Korrespondenzjäger zu sein, auf der Suche nach mystischen Übereinstimmungen zwischen Lauten, Farben, Figuren und Krakeleien, wo immer sie sich aufstöbern lassen. . . . Wir mussen uns den Paraliteraten als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ – Anders Cullhed, Dagens Nyheter
„[Fioretos führt] Lektüren durch, die in puncto Bildung und spekulativer Kraft wirklich schwindelerregend sind. . . . Aris Fioretos befindet sich in der Grauzone zwischen Wissenschaft und Kritik, äußerst bewusst hat er seinen Ort gewählt. Mit Das graue Buch macht er einen Schritt in den Raum der Dichtung. Das führt zu Literatur auf höchstem Niveau.“ – Carl-Henrik Fredriksson, Göteborgs-Posten
„[Wenn] einen Aris Fioretos’ barocker, bildgespickter Stil anspricht, ist Das graue Buch eine fast unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Gelehrsamkeit.“ – Gabriella Håkansson, Sundsvalls Tidning
„Von kulinarischer Erotik hat man schon einmal gehört, aber ein Bleistiftporno, was ist das? Er entsteht, wenn Grau, stets assoziiert mit Tristesse und Tod, plötzlich mehr Sex-Appeal verströmt als banale Farben. Aris Fioretos gelingt das Kunststück, eine verleumdete Nichtfarbe so verlockend erscheinen zu lassen, dass man hineinbeißen und die Zunge um sie herum rollen lassen will. Ist dies das Geheimnis von Das graue Buch? Dass es alle vergessenen Augenblicke feiert: das Körnchen im Auge, das Warten in der Busschlange, verregnete Tage am Meer und Rotzspuren auf Servietten? Nie mehr werde ich die Nase über einen gewöhnlichen Feldstein rümpfen.“ – Ulrika Kärnborg, Idag
„[Buch des Jahres] Aris Fioretos. Das graue Buch. Behauptet, mit Bleistift geschrieben worden zu sein. Ich glaube hingegen, dass es in bittersüßer Glasur gespritzt ist, denn es ist das einzige Buch dieses Jahr, das einem greifbare, tatsächlich körperliche Wollust geschenkt hat. Dabei saß ich trotz allem in einem kalten Bahnhof in einer fürchterlich hässlichen und verdammt schmutziggrauen, kleinen Stadt. Und kein Glück in meinem Leben und alle Züge abgefahren, obwohl die Uhren nicht stehen geblieben waren und der Regen fiel wie Tränen auf die Stadt und in mein Herz und das der Dichtung. Doch dank Aris Fioretos’ leichter und lustiger Gelehrsamkeit hatte ich einen guten Geschmack im Mund und Farbenfreude im Kopf. Und der Zug kam.“ – Nina Lekander, Expressen
„ . . . eine tour de force . . . “ - Jesper Olsson, Östgöta-Correspondenten
„Es ist ein seltsames und fast unvergleichliches Buch – Das graue Buch –, das Aris Fioretos geschrieben hat.“ – Mikael van Reis, Ord & Bild
„Ein hell leuchtender Stern . . . [Es ist] ein Genuss, dieses originelle, kunstvolle und spannende Buch zu lesen.“ – Björn Sandmark, Bohuslänningen
Links
Graues Quartett · »Etwas Lust am Untergang muß sein«, Interview 2006