
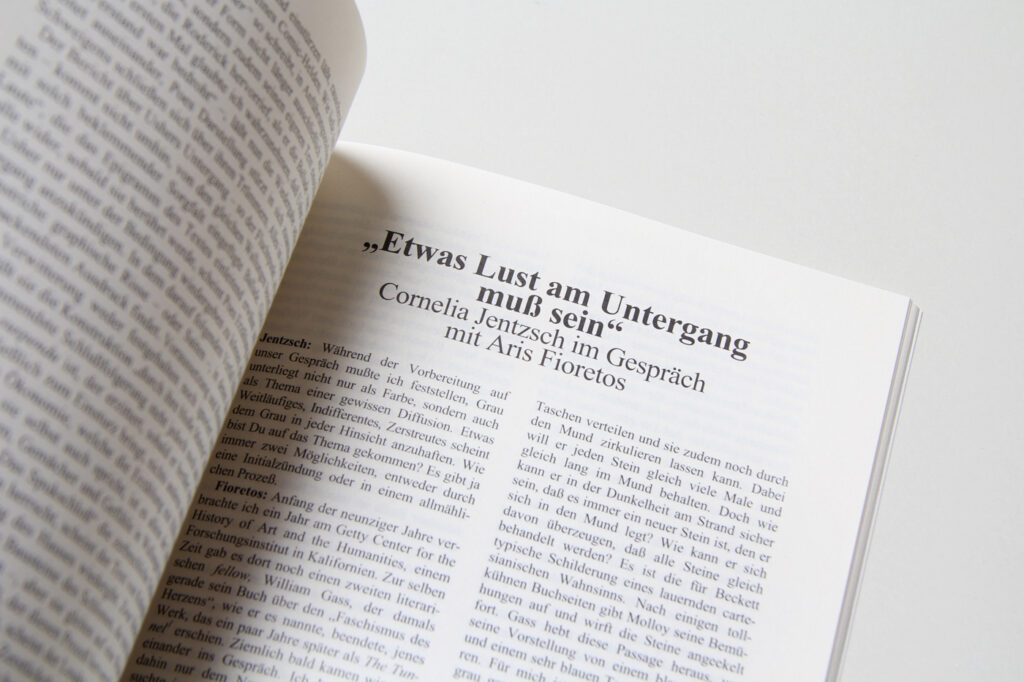

Etwas Lust am Untergang muß sein
Interview · Von Cornelia Jentzsch · Schreibheft · 2006, Nr. 66, S. 169–178
Cornelia Jentzsch: Während der Vorbereitung auf unser Gespräch mußte ich feststellen, Grau unterliegt nicht nur als Farbe, sondern auch als Thema einer gewissen Diffusion. Etwas Weitläufiges, Indifferentes, Zerstreutes scheint dem Grau in jeder Hinsicht anhaftend zu sein. Wie bist Du auf das Thema gekommen? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, entweder durch eine Initialzündung oder in einem allmählichen Prozeß.
Aris Fioretos: Anfang der neunziger Jahre verbrachte ich ein Jahr am Getty Center for the History of Art and the Humanities, einem Forschungsinstitut in Kalifornien. Zur gleichen Zeit gab es dort noch einen zweiten literarischen fellow, William Gass, der damals gerade sein Buch über den „Faschismus des Herzens“, wie er es nannte, beendete, jenes Werk, das ein paar Jahre später als The Tunnel erschien. Ziemlich bald fanden wir uns im Gespräch. Ich hatte Gass bis dahin nur dem Namen nach gekannt und suchte in der Bibliothek zunächst nach seinen Werken. Darunter fand ich ein kleines, 1975 geschriebenes Buch, das On Being Blue hieß. Das Werk, dessen Titel sich auf englisch so angenehm im Mund wölbt, spricht von ‚blau‘ oder ‚melancholisch sein‘. Es ist eine idiosynkratische Meditation über eine Farbe und ihre Bedeutung in der Literatur. Mich hat diese kurze, aber weitreichende Untersuchung, in der Gass ‚blaue‘ Schreibweisen von Joyce bis Rilke, von Gertrude Stein bis John Fowles nachspürt, sofort angezogen.
An einer Stelle kommt er auf Beckett zu sprechen. Am Anfang von Molloy befindet sich Becketts Romanfigur am Strand, wo er sechzehn sogenannte „Saugsteine“ aufsammelt. Molloy versucht ein System zu erfinden, mit dem er die Steine auf seine vier Taschen aufteilen und sie zudem noch durch den Mund zirkulieren lassen kann. Dabei will er jeden Stein gleichviele Male und gleichlang im Mund behalten. Doch wie kann er in der Dunkelheit am Strand sicher sein, daß es immer ein neuer Stein ist, den er in den Mund legt? Wie kann er sich davon überzeugen, daß alle Steine gleichmäßig behandelt werden? Es ist die für Beckett typische Schilderung eines lauernden cartesianischen Wahnsinns. Nach einigen tollkühnen Buchseiten gibt Molloy seine Bemühungen auf und wirft die Steine angeekelt fort. Gass hebt diese Passage heraus, um seine Vorstellung von einem blauen Autor und einem sehr blauen Text zu exemplifizieren. Für mich ist diese Stelle indes immer grau gewesen, wie auch Beckett in meinen Augen stets ein grauer Autor gewesen ist – durchaus im guten Sinne des Wortes. Minimale Variationen innerhalb eines formal strengen Schemas: was könnte grauer sein? Ich wollte verstehen, warum wir dieselbe Stelle, denselben Autor so unterschiedlich sahen. Erst fing ich an, Gass einen Brief zu schreiben. Er wurde jedoch immer umfangreicher, so daß ich am Ende ein Traktat verfaßt hatte, das ich ihm und unseren Kollegen in Kalifornien vorlas. Aus diesem Text entstand schließlich Den grå boken, das 1994 erstmals in Schweden und als The Gray Book 1999 in amerikanischer Übersetzung veröffentlicht wurde.
Jentzsch: Wußtest Du zu diesem Zeitpunkt, daß Grau und Blau etymologisch einen identischen Ursprung besitzen? Beide entwickelten sich aus der gleichen Ausgangsbedeutung heraus.
Fioretos: Ich erinnere mich nicht mehr genau. Wahrscheinlich erfuhr ich es erst im Laufe der Arbeit. Bei Gass steht die blaue Farbe für ein sensualisiertes, erotisiertes, sogar sexualisiertes Schreiben. Früher wurde „verbotene“ Literatur übrigens häufig mit Blau verbunden. Es geht ihm um die Liebe zur und in der Sprache. Als Symbol dafür könnte man den Füllfederhalter heranziehen. Seine blaue Tinte kann immer nachgefüllt werden, seine Schrift bleibt permanent. Dementsprechend steht der Füllfederhalter gleichzeitig für das Prinzip der Sättigung, also des Gedächtnisses, und des Beständigen, also des Ewigen. Dazu wollte ich ein Gegenstück finden. Nach einer Weile stieß ich auf den Bleistift, den ich die ganze Zeit in der Hand hielt. Im Gegensatz zum Füllfederhalter ist er endlich. Er wird immer kleiner, bis er schließlich so winzig ist, das man ihn fortwerfen muß. Auch seine Schrift bleibt nicht beständig, sondern kann ausradiert werden – wobei das Geschriebene auf dem Papier phantomhaft überlebt. Man kann eine Bleistiftspur ja kaum wirklich entfernen. Mit anderen Worten: Der Bleistift steht für Endlichkeit und einen gewissen Umgang mit dem Vergessen, was ihn für mich nicht zuletzt dem Menschen sehr ähnlich machte.
Jentzsch: Du hast viele verschiedene Autoren in deinem Buch zu Wort kommen lassen, Beckett vor allem, Getrude Stein...
Fioretos: Der Text beginnt mit Homer, dem Kronzeugen unserer Literatur. Aber auch Autoren wie Eustache Duchamps, ein Dichter des 14. Jahrhunderts, Edward Young und Klopstock werden eingeladen, um auszusagen. Die Hauptepoche, in der ich Indizien finde, ist allerdings die Zeit nach der Romantik: Wordsworth, Poe, Baudelaire, Valèry, Rilke, Dickinson, Arp, Bataille, Nabokov, der schwedische Dichter Gunnar Ekelöf... Lauter literarische Rezidivisten! Das Buch hat mich viel Zeit in Bibliotheken gekostet. Heute kann man die Zitate wahrscheinlich binnen weniger Stunden mit Hilfe von Suchmaschinen finden. Aber ob das dem philologischen Trüffelschwein dieselbe Freude bei der Entdeckung eines Fundstückes bereitet?
Jentzsch: Wie bist Du Beckett auf seiner grauen Spur gefolgt?
Fioretos: Die Struktur des Buches war ursprünglich so geplant, daß jedes Kapitel einen „Saugstein“ symbolisieren – sozusagen eine Mundmeditation sein – sollte. In der amerikanischen Ausgabe habe ich das geändert, und statt dessen die Finger einer Hand als Organisationsprinzip genommen. Dafür gab es gewisse Gründe. Dementsprechend ist die Einleitung der Daumen, gefolgt von vier Fingerübungen. In beiden Ausgaben versuchen die einzelnen Kapitel die Elemente und ihren Bezug zur Farbe Grauauszulegen – aber etwas anders als herkömmlich. Statt Wasser wird von Tränen, statt Feuer von Rauch, statt Erde von Staub bzw. Kieseln, statt Luft von Wolken gesprochen. Alles Übergangserscheinungen, womit ich dem Temporären deutlicher Gestalt geben wollte.
Bei Beckett fand ich, daß er Grau immer wieder als die Farbe der menschlichen Existenz schlechthin beschworen hat. Grau steht bei ihm nicht bloß für ennui oder für Indifferenz, sondern erscheint als die Farbe einer unendlichen Vielfalt. Das Leben mag trübe sein, bleibt jedoch unerschöpflich nuanciert. An einer Stelle in seinem Roman Watt wird einer dieser nichtigen Zeitvertreibe, für die Beckett bekannt ist, beschrieben, der sehr konkret und zugleich mit diffuser Bedeutung aufgeladen ist. Der Held betrachtet die Asche auf dem Herdrost. „So beschäftigte Watt sich ein Weilchen, indem er die Lampe immer weniger und immer mehr mit seinem Hut bedeckte und die Asche auf dem Herdrost ergrauen, erröten, ergrauen, erröten sah.“ Das Wort im Original ist greyen, ein intransitives Verb, das erst spät – Ende des 19. Jahrhunderts – in der englischen Sprache belegt ist. Die Farbe ist entsprechend nicht nur als ein Adjektiv oder als der Charakter eines Zustandes zu betrachten, sondern besteht zudem in einem Prozeß. Das interessierte mich, denn Grau bedeutet ja in meinem Buch nicht nur, ein Gegenstand der Reflexion zu sein, sondern bezeichnet ebenso einen bestimmten Umgang mit der Welt.
Jentzsch: Im herkömmlichen Verständnis ist Grau eine Unfarbe, eine Negativfarbe, weil in ihr fast nichts passiert. Grau, trist, trostlos – das sagt man so leichthin. Becketts Texte reizen die Misch- und Übergangsverhältnisse von grauen und tristen Situationen bis in immer geringere, unwahrscheinlichere Abweichungen und Nuancen hinein aus. Soweit ich Das graue Buch verstehe, versuchst Du in einem ähnlichen Ansatz in möglichst viele gedankliche Schattierungen hinein produktiv zu werden. Blau bleibt für Dich die Farbe der Romantiker, mit der Du offensichtlich nicht viel am Hut hast. Da scheint Dir das unendliche Grau farbenfroher zu sein. Denn das strahlende Blau erreicht viel schneller ein abgeschlossenes Stadium.
Fioretos: „Es träumt sich nicht mehr von der blauen Blume. Wer heut als Heinrich von Ofterdingen erwacht, muß verschlafen haben“, läßt Benjamin in einem Aufsatz grüßen. „Der Traum eröffnet nicht mehr eine blaue Ferne. Er ist grau geworden. Die graue Staubschicht auf den Dingen ist sein bestes Teil.“ So sieht es eine Moderne, für die der Traum suspekt, die Schlaflosigkeit alles andere als ein Zustand erhöhter Genialität geworden ist. „Man könnte sagen“, meinte Baudelaire, „daß wir Menschen täglich mit einer Kühnheit einschlafen, die unerklärlich wäre, wüßten wir nicht, daß sie auf Unkenntnis über die Gefahr beruht.“ So gesehen ist Grau auch die Farbe der Insomnie.
Jentzsch: Bei dir ist sie nicht nur eine vielseitig einsetzbare und vielfältig aufleuchtende Farbe, sondern spiegelt auch Bewegung wider, Bewegung als universales Prinzip. „Das Grau macht eigentlich erst die Zeit lesbar“, schreibst du.
Fioretos: Für Goethe war die erste wirkliche Farbe ein „glänzender Schatten“ – die Mischung aus Weißem, Abstraktem und Ideellem, kurz: Geistigem, und der schwarzen, aus Erfahrungen bestehenden Materie. Eben grau. Diesen Schatten verband er mit dem endlichen Menschsein. Somit war die erste wirkliche Farbe überhaupt ein Gemisch; sie bildete den Grund aller weiteren. In dieser Beobachtung liegt die DNS meines Buches. Einleuchtend fand ich dabei, daß man, wenn man eine Scheibe, auf der sämtliche Farben aufgemalt sind, schnell dreht, auf der kreisenden Scheibe nur Grau sieht. Senkt man jedoch die Geschwindigkeit – dehnt also die Zeit aus, versucht sie in Raum zu verwandeln –, sieht man ihre ganze farbliche Pracht. Das Grau verbirgt einen geheimen Regenbogen. Diese Dynamik wollte ich für das Buch in Anspruch nehmen. Es denkt monoman über eine Farbe nach, aber mit einer gewollten Überfülle an Metaphern. Wenn es argumentiert, dann in und mit Bildern. Ich nannte diese Schreibweise ironisch fioriture. Du kennst sicher den Begriff aus der Kunstgeschichte, wo er für Ornament oder Dekoration, also für das konventionell gesehen Unwesentliche, fürs Blumige, steht. Ich wollte ein unangemessenes Buch schreiben, eins, das over the top war, also alles andere war, als was man herkömmlich als „grau“ identifiziert, und sich somit auch mit den oberflächigen Effekten der Sprache beschäftigte.
Jentzsch: In der italienischen Sprache bezeichnet das Wort fiore ja auch direkt die Blume oder Blüte, verweist also andererseits auf etwas Verlockendes, Auffallendes und Anziehendes, das einen sogartigen Reiz ausstrahlt.
Fioretos: Natürlich spiele ich mit dem Begriff, indem ich meinen Nachnamen mit dem französischen Wort für „Schrift“, écriture, engführe. Mir ging es darum, mit minimalen Voraussetzungen ein Maximum an Üppigkeit und Pracht zu erzeugen. Muß ein Buch über die Farbe Grau selbst grau sein? Dabei kam mir die Blume recht gelegen, da sie ja die rhetorische Seite der Sprache andeutet. Es geht in dem Text aber nicht nur um Fülle und Feierlichkeit. Im Gegenteil. Im Grunde schildert er einen sterbenden Augenblick in slow-motion. Mein schwedischer Verlag, der durchaus kommerziell ist, hat sich bei der Gestaltung meiner Bücher immer merkwürdig tolerant gezeigt. Daher hat die schwedische Ausgabe von Das graue Buch zwei etwas kostbare Klappen. Wenn man sie aufschlägt, steht auf der Innenseite auf grauem Grund in weißer Schrift, also invertiert, eine Liste von Dingen, die für mich grau sind. Diese bilden metaphorisch so etwas wie die Urmaterie des Buches. Sie enthalten die meisten Bilder, die im Text entwickelt und weitergedacht werden. Die etwas gewagte Idee war, die Klappen sollten die Innenseiten der Augenlider darstellen – ebenjene Innenseiten, auf denen im Augenblick unseres Todes angeblich unsere Erinnerungen vorbeihuschen.
Jentzsch: Das graue Buch ist von dir selbst ins Amerikanische übersetzt worden und kam unter dem Titel The Gray Book 1999 in der „Meridian“-Reihe heraus. Jene von Werner Hamacher für die Stanford University Press editierte Serie, in der ja auch Werke von Agamben, Blanchot, Freud, Jabès, Levinas und Ponge erschienen sind.
Fioretos: Die Reihe zeigt wahrscheinlich, wo sich mein Buch theoretisch am wohlsten fühlt. Es ist mir noch immer etwas unheimlich, aber erst als ich den Text übersetzte – oder besser gesagt: transmorgraphierte –, hatte ich das Gefühl, er kam zu sich selbst. Auf einmal wurde zum Beispiel das Zwiegespräch mit On Being Blue hörbar. Natürlich mußte auf vieles, was die ursprüngliche Gestaltung des Buches betrifft, verzichtet werden. Die schwedische Ausgabe wollte sich auch als Objekt thematisieren. So ist sie zum Beispiel 18 Zentimeter groß, was der Größe eines neuen, noch ungespitzten Bleistifts entspricht. Da der erste Stift, der im Buch zitiert wird (er gehört einem gewissen Hugh Person), 2/3 groß ist, wurde das Buch dementsprechend 12 Zentimeter breit. Diese Aspekte, sowie viele andere, fielen in der amerikanischen Ausgabe fort. In beiden Ausgaben gibt es aber Beispiele des sogenannten type talk, also Stellen, an denen die typographische Gestalt etwas über den Text aussagt. Die erste Zeile des Buches ist daher kaum lesbar. Jede neue Zeile wird etwas schwärzer, bis man auf Zeile neun oder zehn bei voller Schwärze angelangt ist. Der Leser „fällt“ sozusagen in den Text „hinein“, ungefähr so wie jemand, der einschläft oder vielleicht auch dabei ist, zu ertrinken. Bei der schwedischen Veröffentlichung führte diese Extravaganz dazu, daß etwa 200 Exemplare an den Verlag zurückgingen. Die Buchhändler dachten, es wäre ein Druckfehler...
In beiden Auflagen steht auf der ersten Seite, noch bevor der Text anfängt, ein Zeichen. Es sieht aus wie ein auf dem Rücken liegendes C, in dessen Mitte ein Punkt schwebt. Solche Zeichen stammen aus der Typographie des Mittelalters und wurden cryphia genannt, nach dem griechischen Wort für „verborgen“ oder „geheim“. Man setzte sie an den Rand eines Mauskriptes, wenn eine nicht verstandene, eben „kryptische“ Stelle markiert werden sollte. Da alles in meinem Buch um das Vage ging, dachte ich, warum nicht dieses Zeichen dem ganzen Text voranstellen – und die darauffolgende Auslegung als eine Art Gestaltung der Bedeutung des Zeichens verstehen? So schildert der Text für mich diesen Punkt, der über einer hohlen Hand schwebt und langsam nach unten sinkt. Wenn man so will, könnte man das Zeichen sogar als einen leicht gewinkelten Bleistift von unten sehen. (Bei Nabokov, in Pnin, heißt es an einer schönen Stelle: „Wenn man den kurzen Bleistift schräg hielt, krümmte er sich wie eine stilisierte Schlange, doch waagerecht gehalten wurde er ungeheuerlich dick, fast eine Pyramide.“) Heute, fünf oder sechs Bücher älter, kann ich über solche Ausgefallenheiten nur den Kopf schütteln. Es wird mir wohl nie wieder gelingen, soviel Esoterik in ein Werk hineinzupacken.
Jentzsch: Noch einmal zurück zu Goethe, zu seiner ursprünglichen Verschmelzung der Gegensätze Schwarz und Weiß, Schatten und Licht. Dieser Moment symbolisiert gleichzeitig das Anfangsstadium aller Bewegung. Die Antipoden sind zunächst getrennt und stehen für sich, im Moment des Kontaktes, einer energetischen Affäre, dem Ineinanderübergehen und Mischen folgen, kommt ein Ablauf in Gang. Spätestens in diesem Stadium beginnt Zeit. Das steht natürlich dem Tod, der Anhalten, Abbrechen und Beenden assoziiert, gegenüber. Vielleicht nicht unmittelbar dem Moment des Sterbens, wie Du ihn geschildert hast, aber doch dem Danach.
Fioretos: Das graue Buch schildert ein phantomhaftes Leben vermittels Erinnerungen, die in Bildern festgehalten worden sind. Einerseits geschieht dies in der Form eines Essays, der über Literatur, die ich als „graue“ bezeichne, zu sinnieren versucht. Andererseits erzählt das Buch seine eigene Geschichte durch Auslegungen und Inszenierungen anderer Texte. Es versucht also, die Mittel der Literatur zu aktivieren (von einzelnen Interpunktionszeichen über Metaphern bis zur konkreten Buchgestaltung), um über sie zu sprechen. Viele von den im Buch auftauchenden Bilder kehren wieder. Da gibt es jemanden, der nach unten fällt, da tritt ein Fuß ins Leere, da werden Geister aus einer Flasche gelassen... Und ein ums andere Mal kehren Bleistifte wieder. Es ist ein dynamischer Vorgang, in dem die Metaphern und Zitate stets neu entfaltet werden, um zu zeigen, welchen Reichtum sie in sich bergen. Hat man alles bis zum Ende verfolgt, ist wahrscheinlich, es bleibt nur noch die Leere, von der Beckett meinte, sie sei grau.
Jentzsch: Die wiederum ein Hinweis auf den Tod ist. Das Wort „graue Literatur“ gibt es als feststehende Definition in der Bibliothekswissenschaft. Es bezeichnet Bücher und Publikationen, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden, die also offiziell nicht vorhanden sind.
Fioretos: Bei den Bibliothekaren steht das Attribut „grau“ für eine Literatur, für die man keine funktionierende Gattungsbezeichnung hat. Sie ist weder Fakt noch Fiktion, also eher unbestimmbar. Als ich diese Bezeichnung entdeckte, dachte ich, das könnte der Begriff sein für das, was ich suche. Natürlich benutze ich ihn frei und idiosynkratisch.
Jentzsch: Grau schillert, es zeigt sich sowohl als Farbe als auch Zustand. Das Wort erteilt Auskunft über die Abwesenheit von Farben, die ja oft mit Lebendigkeit gleichgesetzt werden, es kann aber auch über den körperlichen und mentalen Zustand einer Person Auskunft geben. Wenn jemand ergraut, verliert er seine Jugend, graues Haar gilt als Zeichen beginnenden Alters. Das Wort „Greis“ liegt etymologisch nahe.
Um noch weiter zu gehen, der graue Zustand läßt sich nur in seinem ganzen Umfang erfassen, wenn man ihn mit einer gleichermaßen grauen, auflösenden, diffusen, umschreibenden Methode veranschaulicht. Das beschreibst du ja in deiner Passage zu Edgar Allen Poes „Untergang des Hauses Usher“. Je unmittelbarer du dich dem Grau, respektive dem Grauen näherst, je deutlicher sich dieser trüb-opake Zustand offenbart, desto mehr versagt die ergründende Methode. Das Grau wird gleichzeitig präsenter und zunehmend weniger faßbar, deshalb wird es unheimlicher, bedrohlicher, mutiert schließlich zum Grauen. Es gibt im späten Stadium des Poeschen Textes keinen fixierbaren Haltepunkt, keinen eindeutigen Schwerpunkt mehr, die Auflösung ist perfekt, die Mauern des Schlosses fallen von selbst.
Fioretos: Vielleicht kann man das Graue nicht fassen, sondern nur zeigen.
Jentzsch: Man kann es zeigen als konstantes Verhältnis des Ineinanderübergehens, das aber an keiner Stelle festzulegen ist. Es läßt sich zwar vermuten, daß es einen Schnittpunkt geben muß, er ist aber nicht verbindlich festzusetzen. Je diffuser Konsistenz und Beschaffenheit der Übergänge werden, desto konkreter verweisen sie auf genau dieses Fließende und sich Wandelnde eines Übergangs. Ich habe viele Anklänge für diese vorsätzliche Verflüssigung gefunden. Der französische Philosoph Francois Jullien widmet sich dem „Faden“, einer Grundkonsistenz aus der chinesischen Philosophie und Kunst. Er sagt, „Fadheit ist der Wert alles Neutralen, der allen Möglichkeiten vorausgeht und sie miteinander verbindet“.
Fioretos: Man kommt vermutlich nicht weit, wenn man über das Graue, das ja auch das Vage ist, in vager Art schreibt. Wahrscheinlich sollte man den umgekehrten Weg gehen und möglichst präzise darüber berichten. Mir war wenigstens wichtig, daß die Bilder, die vorkommen, Prägnanz bekamen. Also, sagte ich mir, schreibe lieber „regenbognerisch“ über die Farbe.
Jentzsch: Was genau stellst du dir unter einer wirkungsvollen Prägnanz und Präzision vor?
Fioretos: Die Metaphern müssen eine Art Evidenz erzeugen. Dabei ist es natürlich nicht schlecht, wenn sie durch ihre sprachliche Gestalt zudem schaffen, etwas im Mund des Lesers zu erzeugen.
Jentzsch: Molloys Steine...
Fioretos: Mm. Die Zungenereignisse. Die Materialität der Sprache spürbar zu machen, diese Fähigkeit haben Autoren wie Gass oder Nabokov. Ihre Texte erzeugen nicht zuletzt kleine Mundmirakel beim Lesen. Auch wenn das Deutsche mir recht vertraut ist, spüre ich diese Körperlichkeit der Sprache komischerweise kaum. Im Schwedischen oder Englischen dagegen sehr deutlich. Bei der Übersetzung des Buches kam es vor, daß sich Bilder nicht wörtlich übertragen ließen. Der Wortlaut war einfach nicht der richtige. Die Präzision fehlte. Dann mußten andere Bilder her, was wiederum Folgen für die Argumentation bekam.
Jentzsch: Du meinst mit präzisem Bild demnach ein Bild, das in der Lage ist, einen Zustand erneut eindringlich im Sinn der Ausgangssituation zu erschaffen? Das Übersetzen ist ja in diesem Sinn ein äußerst grauer Vorgang. Im Moment des Übersetzens befindest du dich weder in der einen noch in der anderen Sprache, sondern dazwischen, am Punkt von versuchter Deckungsgleichheit, extremen Anreizen und elektrisierenden Bildvarianten. Die Verläßlichkeit wie Unsicherheit von Zwischenzonen hat sicherlich viel mit deiner Biographie zu tun. Wenn man zwischen den Sprachen lebt, kann man schlecht in nur einer Sprache präzise werden, sondern der optimale Punkt für Präzision bewegt sich irgendwo dazwischen. Du hast andererseits beim Übersetzen den Vorteil, die Echoräume beider Sprachen nutzen zu können. Dadurch steht dir ein größerer Bereich zur Verfügung, in dem du die Begriffe bewegen und austesten kannst, um genauer zu werden.
Der Berliner Philosoph Hannes Böhringer veröffentlichte vor einigen Jahren im Merve-Verlag ein Buch, das Über die Einfachheit hieß. Er erläutert verschiedene, für die Philosophie und Kunstgeschichte relevante Begriffe, unter anderem kommt er auch auf das Fast Nichts oder „presque rien“, wie es zur Zeit seiner Entstehung im Barock genannt wurde, zu sprechen, dieses zunächst unscheinbare Zünglein an der Waage, das letztlich Entscheidungen auslösen kann. Er schreibt: „Am Anfang, so Lukrez, waren Leere und Atome. Die fielen wie Regentropfen parallel zueinander, ohne sich zu berühren. Dann aber passierte etwas, keiner weiß wieso, fast nichts..., eine winzige Abweichung eines einzigen Atoms ... die Atome geraten aus der Bahn, Wirbel entstehen, Welten.“ In der Philosophie und der Physik funktioniert es nicht anders als in der Sprache und im Goetheschen Farb-Schöpfungsmythos: man gerät immer wieder in diesen zunächst unscheinbaren Grauzonenbereich hinein, der aber voller geheimer und unheimlicher Kraft ist.
Fioretos: Das graue Buch weist wahrscheinlich einige barocke Züge auf. Nicht zuletzt die Verbindung zwischen Üppigkeit und Leere, oder Blume und Tod, wenn du so willst, scheint mir barock. Hinzu kommt natürlich eine gefährliche Vorliebe für die Allegorie – „gefährlich“, weil sie immer auch ihre eigene Auslegung mitdenkt und die Lektüre somit zu einer Art Komplizin macht. Der Text steht in einem theoretischen Spannungsfeld, das mich damals interessierte. Als ich ihn schrieb, hatte ich noch ein zweites Leben als Literaturwissenschaftler an einer amerikanischen Universität. Ich versuchte einen Weg zu finden, wie ich meine Tätigkeiten als Autor und Akademiker miteinander verbinden bzw. ein drittes Territorium entstehen lassen konnte, ohne daß die beiden Rollen allzu sehr miteinander in Konflikt gerieten. Nicht zuletzt Derrida hat in seinen Schriften gezeigt, daß die Philosophie immer bereits von der Literatur heimgesucht ist, sowie die Literatur von Tropen und Figuren zusammengehalten wird, die man durchaus philosophisch betrachten kann. Dieses Interesse und die Grauzone zwischen der eigentlichen Literatur und dem Nachdenken über sie, wofür auch Namen wie Blanchot oder Jabès stehen, diese Obsession habe ich allerdings heute nicht mehr.
Jentzsch: Was löste diese Obsession auf?
Fioretos: Eines Tages verlor ich die Lust an Exegese. Ich fühlte nicht länger das Verlangen, mehr über die Mechanismen der Hermeneutik zu lernen. Alles über ein Auto zu wissen mag bewundernswert sein; persönlich war ich mehr am Autofahren interessiert. Ich glaube, ich hatte nicht nur verstanden, sondern in der eigenen Praxis wirklich erfahren, als Autor muß man auf seinen Instinkt vertrauen. Das einzige, was etwas bedeutet, ist der erste Impuls. Du kannst dich jedoch immer nur auf das ,zweite‘ Wort verlassen, das heißt, mußt das Wort hinter dem Wort finden – ein Wort gegen ein passenderes austauschen, dann dieses gegen ein noch passenderes. Für den Kritiker gilt das Gegenteil. Wenn du in hermeneutische Abenteuer verwickelt bist, kannst du nie dem ersten Impuls nachgeben. Du mußt dich stets auf den zweiten verlassen, will sagen, auf die Reflexion. Meistens genügt dabei allerdings das erste Wort. (Ich sage dies nicht um den sogenannten literary criticism zu beleidigen, viele seiner Vertreter sind anständige Autoren. Aber schau dir die entsprechenden Texte an. Die meisten werden meinen Eindruck bestätigen.) Diese Differenz ist so etwas wie das Genom der Literatur. Ich gestehe, es ist eine plattfüßige Formel und peinlich einfach zu dekonstruieren. Nichtsdestotrotz entwickelte sie für mich zwei distinkte Wahrheiten über die Literatur. Und als ich das erkannte, dauerte es nicht lange, bis ich verstanden hatte, das akademische Leben bot mir in seiner traditionellen Form nicht, worauf ich aus war.
Hinzu kam, daß mir die Denkfiguren, die in der Literaturtheorie vorkamen, für die ich mich damals interessierte, irgendwann zu vertraut schienen. Immer wieder wurde – durchaus sinnreich, durchaus verschlagen – gezeigt, wie Möglichkeitsbedingungen eigentlich „Unmöglichkeitsbedingungen“ waren. Ich habe große Sympathie für diese Auffassung von Literatur, fand ihre Vorgehensweisen aber zunehmend vorhersehbar. Weil mir die Luft in ihr zu dünn wurde, versuchte ich sie mit anderen thematischen Bereichen zu infizieren – fing an, mich ernsthafter mit Biologie, Medizin- und Kulturgeschichte auseinanderzusetzen –, auch um zu testen, ob sie das aushielte. Blanchot, die eminence grise schlechthin einer gewissen Literatur, hat nur selten seine beiden Tätigkeiten – einerseits als Autor von Romanen und Kurzgeschichten, andererseits als Kritiker, sogar Theoretiker der Literatur – miteinander verbunden. Ihm gelang es, sich nicht treu zu bleiben. Bei Blanchot sind die beiden Tätigkeiten zwei Welten, die sich manchmal überschneiden, manchmal auch nicht. Diese Haltung schätze ich zunehmend. Heute betrachte ich die Bücher, die ich bis Mitte der neunziger Jahre schrieb, zwar nicht ohne Nachsicht, wohl aber aus einer kaum kleiner werdenden Distanz. Sie sind von einem Autor geschrieben worden, dessen Vorlieben mir nicht mehr vertraut sind.
Jentzsch: Denkst du, daß die Dekonstruktion als Theorie und Methode an einem unwiderruflichen Endpunkt angelangt ist?
Fioretos: Mit dem Begriff eines „Endpunktes“ wäre ich vorsichtig. Gerade die Dekonstruktion hat ja gezeigt, wie widersprüchlich solche Vorstellungen sind. Der Begriff eines Endes mit seinen eschatologischen Vorstellungen ist inzwischen zutiefst verunsichert worden. Man kann sozusagen vor lauter Aufhören nicht enden.
Jentzsch: Ich habe als universelles Symbol dafür sofort das Unendlichkeitszeichen der Mathematik vor Augen. Vermutlich werden, das Ende vom Anfang her betrachtet, auch die Astrophysiker niemals einem eindeutigen Moment der Weltentstehung begegnen. In keinem materiellen wie ideellem Forschungsbereich scheint man heute Ursprünge unmißverständlich definieren zu können, obwohl man diesem Ziel immer näher zu kommen glaubt. Die Ahnung macht sich breit, daß die Methoden des unendlichen Zerkleinerns und Untersuchens in ihrer Summe nichts Neues bringen werden, denn alles bewegt sich nur erneut in permanent unendliche Felder hinein. Das heißt, irgendwann verändert der neugierige homo sapiens einfach nur zwangsweise die gerade favorisierte Methode, um die, wie er meint, substantielle Bewegung des Forschens weiter aufrecht erhalten zu können.
Fioretos: Teufel sei Dank muß man als Autor nicht viel über den Motor seines Fahrzeuges wissen, um sich beim Fahren vergnügen zu können.
Jentzsch: In der Mathematik, die schlechthin als Präzedenzfall für Exaktheit und Präzision gilt, gab es im vorigen Jahrhundert eine interessante Entwicklung. Diese Zahlenwissenschaft konnte im Bereich der Computerentwicklung nur noch genauer dort werden, wo sie statt klar festgelegter numerischer Ausgangsparameter plötzlich ungenaue, diffuse benutzte. Es entstand die sogenannte fuzzy logic oder „unscharfe Logik“. Mit ihrer Hilfe vermochten die Mathematiker einem Computer endlich den obligaten Spielraum, der ansonsten ausschließlich zwischen Ja und Nein, zwischen Schwarz und Weiß lag, zu erweitern. Durch die Einführung sogenannter linguistischer Variablen, die zum ersten Mal Zwischenwerte bzw. Wahrheitswerte wie „ziemlich“ oder „annähernd“ zuließen, erreichten mathematische Berechnungen jetzt Übergangszonen, die ansonsten nicht greifbar gewesen wären. Komplexe Vorgänge lassen sich also dort am genauesten erfassen, wo man ihnen weitläufigen Raum zum Abweichen läßt. Vielleicht sollte man an dieser Stelle den Begriff der Präzision ergänzend präzisieren.
Fioretos: Du sprichst vom Einführen von Grauzonen in genau kalkulierten Denkfeldern. Ungefähr so stelle ich mir vor, daß man mit dem Ungenauen, bzw. Unpräzisen umgehen könnte. Hier wird das „Grau“ sozusagen zum Platzhalter.
Jentzsch: Wann funktioniert für dich am prägnantesten und präzisesten deine Sprache?
Fioretos: Es ist wahrlich eine Rarität, dieses Gefühl von Unausweichlichkeit. Bestimmt lassen sich solche Momente an den Fingern einer Hand abzählen. Ich bin eigentlich ein notorischer Umschreiber – und zudem Prosaautor. Ich kann also keinem Reim oder Metrum die Aufgabe überlassen, zu entscheiden, wann eine Zeile ,fertig‘ ist. Bei der Arbeit gibt es meistens einen Punkt, an dem die eher ernüchternde Einsicht einkehrt: ich muß mich zufrieden geben. Diesen demütigenden Moment versuche ich immer so weit vor mir her zu schieben, bis ich den Eindruck bekomme, nun läßt sich kaum noch ein Wort entfernen – und schon gar nicht hinzufügen. Nun schwebt der Text von selber. Dann wirst du als Autor vom Text aus dem cockpit herauskatapultiert. Dir bleibt nur übrig zu schauen, daß du schön auf die Füßen landest.
Jentzsch: Könntest Du diesen optimalen Zustand noch schärfer fokussieren?
Fioretos: Bei der Faszination für ein Thema, ein Sujet, geht es mir ähnlich. Lange sammele ich Beobachtungen und Eindrücke, Fetzen von Dialogen, Phrasen und Attribute. Aber erst wenn ich den richtigen Magneten gefunden habe, um ihn in diesem Spannungsfeld einzuführen (es kann ein gewisser Ton sein, aber auch eine Eigenheit einer Romangestalt oder einer bestimmten Spannung zwischen dem, was gesagt, und dem, was ausgelassen wird), erst dann fangen die Splitter an, sich in Mustern zu ordnen. Dafür muß man vor allem immer wieder versuchen, seine Aufmerksamkeit zu schärfen.
Jentzsch: Das graue Buch scheint für dich so ein Spannungsfeld darzustellen. Es enthält zahlreiche Splitter: Anspielungen, Zitate, Verweise auf Autoren quer durch die Jahrhunderte, Gedanken, Historisches, Projektionen, um nicht zu sagen Projektile. Alles das wird vom Magneten „Grau“ zusammengehalten und ausgerichtet. Übrigens besitzt das Mineral Magnetit tatsächlich eine graue, und zwar eine dunkelgrau- bis schwärzliche Färbung. Was reizt dich an diesen denkarchäologischen Splittern und Scherben?
Fioretos: Es gibt die berüchtigte Belegstellengermanistik, die Fundstücke mit wenigen Sätzen zusammenfügt, um das Ganze als Dissertation durchzusetzen. So etwas interessiert mich nicht. Wenn ich solche Arbeiten lesen muß, leide ich immer an Verstopfung. Aber ich neige zu einer gewissen Sammlertätigkeit. Das graue Buch lebt nicht zuletzt von Textstellen, die wie Wrackstücke an einen Strand gespült werden. Doch anders als die Promovierenden wollte ich mit diesen Fundstücken spielerisch umgehen. Meine Zitate färben ja auf den umgebenden Text ab, was sich kein Wissenschaftler erlauben kann. Eine Stelle von Nabokov aus dem berühmten dritten Kapitel von Transparent Things („Durchsichtige Dinge“) – wo er durch die Augen seiner Hauptperson, Hugh Person (ein Name, der auch als ein kleiner Appell an den Leser – you, person – verstanden werden kann), die Regression eines Bleistiftes bis zu dessen Anfängen in Shakespeares Todesjahr, 1616, in Keswick in England zurückspult –, taucht zum Beispiel bruchstückhaft im Buch auf. Immer wieder kehrt mein Text zu den Vorstellungen zurück, die hier zum Ausdruck gebracht werden.
Jentzsch: Das Wort „Grau“ entstand aus einer viel helleren Bedeutung, als sich aus der jetzigen Verwendung ahnen lässt. „Grau“ entwickelte sich aus der Wurzel ghre- heraus, die ursprünglich Strahlen, Glänzen oder Schimmern meinte. Dieses Lichthafte hat sich im Lauf der Sprachgeschichte in seinen Schatten verkehrt. Mit Grau verbinden wir heute Assoziationen wie Beton, stumpf, trüb, neblig, schlicht Tristesse eben. Die etymologische Verdunkelung des Wortes erreicht im „Grauen“ sogar den Grad einer tiefgreifenden existentiellen Furcht.
Fioretos: „Grau“ hat eine onomatopoetische Qualität, die ich mag. Il fait gris, sagt Clov zu Hamm. Gris! GRRIS! Herrlich, dieses gr. Während der Arbeit am Buch interessierte es mich, die verschiedenen Themenbereiche, die sich durch diesen kratzenden Laut öffnen, zu erforschen. Er steht ja in einem gewissen Gegensatz zur Blähung des „Blau“, diesem protuberantischen bl, das etwas Sinnliches, wenn nicht Erotisches hat, und von dem viele Autoren – Joyce, Stein, Gass – fasziniert gewesen sind. Mich lockte es, in beide dieser entgegengesetzten Richtungen weiterzudenken.
Jentzsch: In den Anfangskonsonanten gr erscheint sofort ein Widerstand. Die Farbe bekommt dadurch etwas Taktiles und verfestigt sich praktisch in eine Konsistenz. Grau verbindet man sofort mit hartem Gestein. Es steigert sich bis in Situationen extremen Empfindens, auch Widerwillen – beispielsweise gegen das Grauen – ist eine harte Entgegensetzung. Eine interessante Entwicklung, wie ein Wort mit Energie beladen wird, oder besser noch, wie ihm Energie entzogen wird. Kannst du noch etwas zur Evolution des Wortes „Grau“ in den einzelnen Kapiteln deines Buches sagen?
Fioretos: Im ersten Kapitel geht es um Tränen, das heißt, um liquide Zustände und Verflüssigung – vor allem vielleicht um die Verflüssigung eines als feste Größe, oder besser: Kontur, verstandenen Ichs. Die Urszene dieser ,Liquidation‘ fand ich im ersten Buch der Ilias. Darin entfernt sich der enttäuschte Achilles von den übrigen Griechen, weil Agamemnon die eigentlich ihm zustehende Beute zugesprochen wurde. Achilles sondert sich ab, behauptet seinen Status als Individuum und geht zum Strand hinab. Als er über das Meer blickt, kommen ihm die Tränen. Später wird Thetis, seine dem Wasser entstiegene Mutter, ihn trösten und schließlich überreden, ins Kampfgetümmel zurückzukehren. Davor befindet sich Achilles aber in einer Art Grauzone, allein und verstimmt. Homer bezeichnet das Wasser, worauf sein Held schaut, als ein „graues“. Das hat mich elektrisiert, denn soweit ich weiß, ist dies die erste Stelle in der westlichen Literatur, wo die Farbe mit einem mentalen Zustand sozusagen korrespondiert. Das Wasser vor Achilles Augen erweckt ja bei ihm die Tränen in seinen Augen. Subjekt und Objekt lassen sich nicht mehr deutlich voneinander trennen. Das Ich und die Welt verschwimmen ineinander – so wie wir es beim Weinen so peinlich erleben müssen.
Jentzsch: Wenn man den grauen Punkt verläßt, kommt man entweder zu weiß oder zu schwarz. Also impliziert Grau zwangsweise stets den Umkehrpunkt. Rein optisch kann der Mensch übrigens etwa 500 Grautöne unterscheiden.
Fioretos: Diese Grauzone ist sehr reichhaltig, mit ihr kommt die Dramatik der Illias erst wirklich in Gang. Ohne die Differenz zwischen Heer und Held, Gemeinde und Individuum, würde der Text seine ganze Tragik nicht entfalten können. Erst nachdem Patrokles stellvertretend für Achilles stirbt, begibt sich der Held des Epos wieder ins Gefecht. Die Grauzone, in der er sich befunden hat, erweist sich als Übergangserscheinung. Nun kehrt das Kriegesglück zu den Griechen zurück. So habe ich nach anderen Stellen gesucht – wie etwa bei Valèry, Ekelöf oder Arp, der übrigens ein schönes Lied geschrieben hat, „Die graue Zeit“ genannt, in dem er der Beziehung zwischen dem Grau und Tränen nachgeht –, wo ähnliche Verflüssigungen zwischen Ich und Welt stattfinden. Bataille hat den Prozeß auf den Punkt gebracht, indem er vom Tränenvergießen als quelque chose de grisant sprach.
Das zweite Kapitel behandelt den Rauch und seine verschiedenen Übergangsformen. Kulturgeschichtlich wird die Melancholie wohl zumeist mit Tränen und Flüssigkeiten verbunden. Ich suchte ihre trockene Variante und stieß auf etliche Texte, in denen Schwermut mit Dunst, Dampf und Gewölk verbunden wird.
Jentzsch: Die Extreme Feuer und Wasser nähern sich genau in dieser Konsistenz an: Rauch läßt sich schwer von Nebel unterscheiden.
Fioretos: In seiner Erzählung über den „Untergang des Hauses Usher“ zeigt Poe, wie unheimlich diese Erscheinungsform des Grauen sein kann. Die Zerbröselung von Strukturen, die man in diesem Text verfolgen kann, wird im dritten Kapitel des Buches aufgenommen. Hier geht es um grain, das französische Wort für „Korn“ oder „Körnigkeit“. In einem seiner schönsten Texte spricht Roland Barthes über das „Körnige“ einer Stimme...
Jentzsch: Er bezieht sich vermutlich auf das Timbre, die individuelle Färbung einer Stimme?
Fioretos: Er meint, gäbe es dieses Kratzende nicht, wäre die Stimme eines Opersängers bloß perfekt. Erst durch das grain erhält sie ihre Idiosynkrasie, die kleine Abweichung vom Erwarteten, was die wirkliche Schönheit ermöglicht. Durch das Körnige bekommt die Stimme ihre Einmaligkeit; erst durch es wird sie erkennbar. Man kann aber schwer sagen, worin dieses grain besteht. Hat es wirklich eine eigene Materialität? Diese Frage führt im dritten Kapitel zu einer längeren Meditation über die Null – als Ziffer, Zahl, Zeichen, Figur. Die Null, eine späte Entdeckung, die erst mit der arabischen Kultur in die europäische kam, ist ja fast nichts. Aber eben nur fast. Denn als Zeichen besitzt sie eine hartnäckige Materialität. Auf den Rechentafeln der Römer konnte sie nur durch Abwesenheit einer Markierung gezeigt werden. Mit der arabischen Null bekam man endlich einen konkreten Platzhalter.
Jentzsch: Dabei ermöglicht die Null, wenn man sie nicht als Abwesendes und Leeres begreift, sondern als Summe mathematischer Möglichkeiten, überhaupt erst das Rechnen mit komplizierten Formeln. Die Mathematik, wie wir sie heute kennen, konnte sich erst aus der Vorstellung einer überfüllten Zone heraus entfalten.
Fioretos: Für mich hat das, was Barthes grain nannte, diese Qualität. Es ist der Platzhalter eines „fast Nichts“. Nehmen wir ein Beispiel aus der Literatur: Josefine, die Sängerin der Mäuse bei Kafka. Sie gehört einem Volk an, das angeblich „Musik nicht liebt“. Sie aber, als einzige, hegt diese große Sehnsucht nach Musik „und weiß sich auch zu vermitteln; sie ist die einzige; mit ihrem Hingang wird die Musik – wer weiß wie lange – aus unserem Leben verschwinden“. Trotz Josefines einzigartiger Stellung unter den Mäusen ist ihr Gesang dennoch nichts Bemerkenswertes. Eigentlich „müßte man vor diesem Gesang zunächst und immer das Gefühl des Außerordentlichen haben, das Gefühl, aus dieser Kehle erklinge etwas, was wir nie vorher gehört haben und das zu hören wir auch gar nicht die Fähigkeit haben, etwas, was zu hören uns nur diese eine Josefine und niemand sonst befähigt.“ Aber, behauptet Kafkas anonymer Erzähler, „gerade das trifft aber meiner Meinung nach nicht zu, ich fühle es nicht und habe auch bei andern nichts dergleichen bemerkt“. Timbre, Volumen, Färbung – all die Merkmale des echten Gesangs fehlen. Kurzum: Josefine bietet ein Singen ohne Gesang. „Wenn darin etwas von Musik enthalten sein sollte, so ist es auf die möglichste Nichtigkeit reduziert.“
Jentzsch: Im letzten Kapitel deines Buches kommst du schließlich auf eine Substanz zu sprechen, die - schwebend, zerstreut, undurchsichtig und weißlichgrau - eine nochmalige Verdichtung des zweiten Elements aus der philosophischen Lehre des Empedokles ist. Es führte wohl als erster die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde, auf die du dich ja in deinem Buch beziehst, in die klassische Philosophie ein. Der Grieche war der Ansicht, es gibt kein Werden und Vergehen, also wenn du so willst keinen schwarzen oder weißen Endzustand. Die Welt besteht grundsätzlich nur aus Mischung und Entmischung. Empedokles war ein früher Vertreter der „grauen“ Variante.
Fioretos: Das vierte Kapitel richtet den Blick in die Luft, dorthin, wo Josefines nichtiges Singen verklingt. Es enthält einige Meditationen über Wolken – von Wordsworth und Baudelaire bis hin zu Friedrich Theodor Vischers merkwürdigem „Graues Lied“ –
Mir ist, als wär‘ ich selber Grau in Grau,
Zu viel der Farbe scheint mir selbst das Klagen,
Ob Leben Nichts, ob Leben Etwas ist,
Wie sehr ich sinne, weiß ich nicht zu sagen.
– und danach löst sich das Buch sinngemäß auf.
Jentzsch: Mit anderen Worten, das Buch stellt in seiner eminenten „grauen“ Funktionsweise und in seiner nuancierten Anwesenheit exakt das dar, worüber es gerade spricht. In der Mathematik steht als Abschluß unter längeren logischen Operationen: quod erat demonstrandum.
Fioretos: Wenigstens flirtet der Text mit der Spannung zwischen Sagen und Tun, Thema und Figur. An Einsichten mag für den Leser wenig dabei herauskommen, aber zumindest das ist geschehen: Die Zeit, die er braucht, um vom einen Buchdeckel zum anderen zu gelangen, hat sich ereignet. Das ist ein „fast Nichts“, eine „möglichste Nichtigkeit“, die sich nicht rückgängig machen läßt. Dieser sich bei der Lektüre entfaltenden Temporalität habe ich oft näher zu kommen versucht. Dank des Versinkens in einen Text bildet sie für mich einen Raum, eine Grauzone. Man steigt in eine „andere“ Zeit ein, bleibt dennoch auch in der alten. Man löst sich, wenn man wirklich von einem Buch erfaßt wird, als aktives Subjekt ja immer leicht auf. Ich finde diese Erfahrung lustvoll und habe sie in manchen Büchern thematisiert. Aber keins ist wohl dabei so radikal gewesen wie Das graue Buch. Heute sind mir seine theoretischen Bemühungen fremd geworden. Nur diese Erfahrung einer „anderen“ Temporalität ist mir immer noch sehr nah. Wie schreibt Hans Arp?
Ich fühle wie die graue Zeit durch mich zieht.
Sie höhlt mich aus.
Sie bleicht meine Träume.
Sie zieht schon so lange durch mich.
Ich liege am Strand eines ausgeflossenen Meeres
am Rand einer ungeheuren Muschel.
Es zerbröckelt es verwittert um mich
und rinnt in die Tiefe.
Langsam zerfällt der Raum.
Etwas Lust am Untergang muß noch sein.